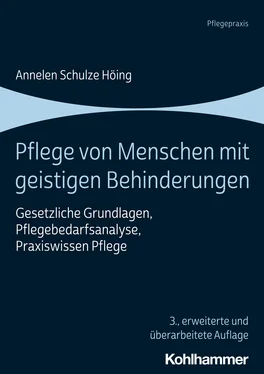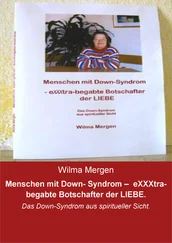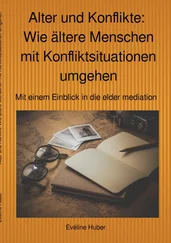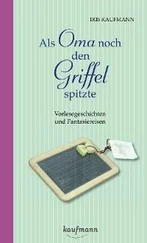1 ...7 8 9 11 12 13 ...25 Handlungsgrundsätze sind bspw. die Nutzung bebilderter Arbeitsanweisungen durch den Arbeitgeber oder ein Busfahrplan, der mit Farben und Piktogrammen statt Schriftsprache arbeitet.
Neben der aktuellen Umwelt hat die Vergangenheit einen großen Einfluss auf die aktuelle Situation von Menschen (Kastl, 2009). Daher werden unter personbezogenen Faktoren wichtige Lebenshintergründe benannt. Personbezogene Faktoren sind demnach individuelle, vergangene Hintergründe eines Menschen, die heute eine besondere Bedeutung haben und dabei helfen bestimmte Situationen zu verstehen. Personbezogene Faktoren beschreiben demnach den sozialen und biografischen Hintergrund, soweit dieser einen Einfluss auf den Bedarf hat.
Herr P. hat bis zum Tod seiner Eltern in einem kleinen Dorf gelebt. Die Großmutter lebte im selben Haus und machte Herr P. jeden Sonntag Schokopudding. Nach dem Tod der Eltern ist Herr P. in eine Einrichtung gezogen. Herr P. hat große Schwierigkeiten die Wochentage zu benennen und ist in seiner zeitlichen Orientierung beeinträchtigt. Er fragt jeden Tag: »Schokopudding?« Für Herrn P. ist Schokopudding ein Anhaltspunkt, dass Sonntag ist.
1.3.3 Zusammenfassung der relevanten Situationen und der Teilhabe
Vor der Zielplanung und darauf aufbauend der begründeten Darstellung der Leistungen, betrachtet die Bedarfsermittlung abschließend die Teilhabesituationen.
Teilhabe im Verständnis der ICF bezieht sich auf das Einbezogen sein in Lebenssituationen (WHO, 2005). D. h. die Teilhabe fragt nach den Wechselwirkungen zwischen den inneren Möglichkeiten einer Person, eine Handlung auszuführen, und den förderlichen und hinderlichen Kontextfaktoren. 14
Hier sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Ziel der Zusammenfassung ist zu beschreiben, welche Umweltfaktoren in welchen Situationen unterstützend wirken und welche Umweltfaktoren den Zugang zu diesen Situationen erschweren bzw. verstellen.
Ausgehend von den Leitzielen und den Lebensvorstellungen der betroffenen Person kann so eingeschätzt werden, welche Situationen erhalten bleiben sollen und welche im nächsten Planungszeitraum verändert werden können.
Dieser Schritt ermöglicht eine gemeinsame Reflexion über die Teilhabe der betroffenen Person und soll dabei helfen im Bogen D individuelle Ziele zu finden und zu vereinbaren.
Frau P. kann nicht sprechen. Ihr ist jedoch wichtig selbst zu entscheiden, was sie anziehen möchte. Sie kann auf eine Tafel mit Bildern zeigen, auf der verschiedene Kleidungsstücke abfotografiert sind. Morgens schaut eine Assistenz gemeinsam mit ihr, was sie an dem Tag anziehen will.
Förderlich in dieser Situation sind für Frau P. die Tafel mit Bildern und die unterstützende Assistenz, die gemeinsam mit Frau P. aussucht. Beides sind Umweltfaktoren. Kann Frau P. entscheiden, was sie anzieht und ist insoweit Teilhabe gegeben? Ja, das ist wegen der Förderfaktoren in der Umwelt der Fall.
1.3.4 Die Ermittlung des Unterstützungsbedarfs
Die konkreten Ziele, je nach Bundesland bzw. Instrument S.M.A.R.T Ziele, haben im Rahmen der Bedarfsermittlung drei Aufgaben.
1. Die Ziele klären, wofür es sich einzusetzen lohnt und wer was dazu beitragen kann, die Ziele zu erreichen. Ziele verpflichten alle Beteiligten, ihr Handeln am Ziel der betroffenen Person auszurichten.
2. Ziele konkretisieren, in welchen Situationen Zugänge erhalten bleiben sollen (Erhaltungs- bzw. Stabilisierungsziel) und in welchen Situationen neue oder andere Zugänge geschaffen werden können (Veränderungsziel). Ziele steuern demnach die Leistungen unter dem Gesichtspunkt der Eignung der Maßnahme.
3. Ziele benennen den Handlungsrahmen. Über die Ziele ist begrenzt, an welchen Stellen die betroffene Person Unterstützung will bzw. an welchen nicht oder formulieren konsensual, an welchen Stellen Unterstützung fachlich angemessen ist.
In teilhaberelevanten Lebensbereichen (nicht in allen!) werden Ziele für den kommenden Zeitraum formuliert und vereinbart.
Hierzu können grundsätzlich zwei verschiedene Zielvarianten unterschieden werden.
Veränderungsziele beschreiben, was sich im Vergleich zur aktuellen Situation verändert haben soll. Hier ist positiv zu benennen, was anders als jetzt sein soll und woran alle beteiligten Personen erkennen, dass dieser Zustand eingetreten ist.
Herr V. hat eine psychische Erkrankung. Er erlebt immer wieder Phasen, in denen sein Antrieb stark beeinträchtigt ist. Dies wirkt sich dahingehend aus, dass er dann nicht zum Fußballplatz gehen kann, obwohl er dies eigentlich möchte.
Das Ziel könnte sein: Herr V. ist jeden Sonntag auf dem Fußballplatz.
Erhaltungsziele formulieren Situationen in der Zukunft, die so bleiben sollen, wie sie jetzt sind, also in denen die betroffene Person mit der Unterstützung, die sie bereits hat, so teilhat, wie sie sich das vorstellt.
Frau M. ist es wichtig selbst auszusuchen, mit welchem Badesalz sie badet. Sie kann nicht ohne Unterstützung einkaufen gehen.
Das Ziel könnte sein: Frau M. entscheidet weiterhin selbst, welches Badesalz sie einkauft.
Erhaltungsziele sind auch für täglich wiederkehrende Situationen zu benennen, wenn diese erhalten werden sollen.
Herr W. geht gerne in die Werkstatt, er ist in seiner zeitlichen Orientierung und in der Aufrechterhaltung und Durchführung der täglichen Routine beeinträchtigt. Hierbei hilft ihm eine Assistenz. Diese weckt ihn morgens und gibt ihm in der morgendlichen Routine eine Orientierung zu den einzelnen Schritten, wie Anziehen, beim Frühstück und auf dem Weg zum Bus.
Das Ziel könnte sein: Herr W. ist weiterhin pünktlich bei der Arbeit.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind eine Reihe von Maßnahmen nötig, die wiederkehrend zu erbringen sind, so lange Herr W. in der Werkstatt arbeitet.
Ziele benennen eine konkrete Situation in der Zukunft. Wichtig ist es, festzuhalten, bis wann das Ziel voraussichtlich erreicht sein soll bzw. zu welchem Zeitpunkt überprüft werden soll, ob das Ziel bereits ganz oder teilweise erreicht wurde. Wichtig ist weiterhin, dass die Ziele keine Aussage darüber enthalten, was gebraucht wird, um sie zu erreichen.
Die Frage, »was« oder »wen« jemand braucht, um das Ziel zu erreichen, sind Maßnahmen, Tätigkeiten oder Verrichtungen.
Daher wird unter den Maßnahmen und nicht in den Zielen beschrieben, welche personelle und technische Unterstützung benötigt wird, um das Ziel zu erreichen, wer daran beteiligt ist und wo etwas getan wird.
Den Zeitraum einzuschätzen, bis wann die Ziele erreicht werden können, stellt die fachliche Grundlage zur weiteren Planung dar. Zur Begründung, wie oft und wie lange die Unterstützung benötigt wird, ist ein inhaltlicher Rückbezug auf die Beurteilung der Situation und Operationalisierung in den neun Lebensbereichen notwendig. Die Dauer kann über die Analsyse der Aktivitäten nachvollzogen und abgebildet werden. D. h. ausgehend von dem Ziel können die relevanten Fähigkeiten und Beeinträchtigungen betrachtet werden. Wie wirken sich diese im Alltag aus und in welchen Situationen ist hier eine Unterstützung erwünscht und notwendig?
Es werden somit folgende Fragen beantwortet:
Was ist zu tun, damit das Ziel erreicht werden kann?
Wie wird das getan, also welche Methoden oder Kompetenzen werden benötigt, um das Ziel zu erreichen?
Wer tut etwas, damit das Ziel erreicht werden kann?
Читать дальше