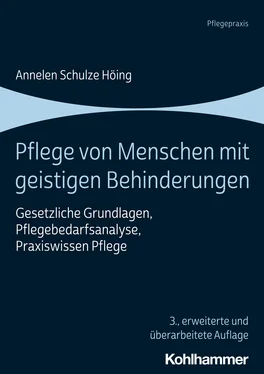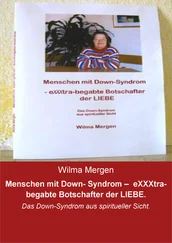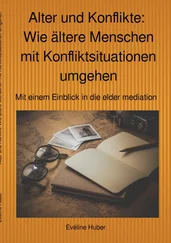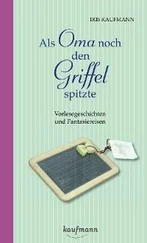Vorbereitung für Fachkräfte, die den Bedarf ermitteln
Fachkräfte, die die Bedarfsermittlung durchführen, sind oft in einer Doppelfunktion am Gespräch beteiligt. Sie kennen die leistungsberechtigte Person möglicherweise aus dem Alltag als Unterstützerin. Zugleich ordnen und strukturieren sie den Prozess der Bedarfsermittlung und schätzen die Situation fachlich ein. D. h. sie üben keine Kontrollfunktion aus, sondern können im Dialog die verschiedenen Perspektiven (inkl. ihre eigenen) fachlich einordnen, um so den Bedarf umfassend abzubilden. Eine Vorbereitung auf das Gespräch ist hierbei wichtig.
Eine zentrale Aufgabe in der Vorbereitung ist es, die gesundheitliche Situation und die persönlichen Daten der leistungsberechtigten Person zu erfassen. Alle in Deutschland zum Einsatz kommenden Bedarfsermittlungsinstrumente wie B.E.N.I., ITP, BEI-BW, TIB, etc. bieten entsprechende Felder.
Ein Bogen dient dazu, die gesundheitliche Situation individuell darzustellen, d. h. hier können alle Informationen, die eine Aussage über die gesundheitliche Situation erlauben, benannt werden.
Es werden nur in den Feldern Einträge gemacht, für die uns Informationen vorliegen. Wenn etwas unbekannt ist, bleibt das Feld leer.
Materialien:
• Medizinische oder ärztliche Stellungnahmen
• Therapeutische Unterlagen oder Berichte
• Pädagogische Berichte
Die ärztlichen Diagnosen nach ICD-10 sollten angegeben werden, die zum Zeitpunkt der Bedarfsermittlung vorliegen. Sollten keine nach ICD verschlüsselten Diagnosen vorliegen, so ist der medizinische Sachverhalt im Freitext zu beschreiben.
Eine Beschreibung von Schädigungen der Körperfunktionen nach ICF dient der Konkretisierung der Diagnostik und bietet gleichzeitig eine Grundlage für einer Plausibilisierung der Ergebnisse.
Liegen keine Befunde oder Angaben zu den Körperfunktionen vor, so bleibt dieses Feld leer. 12
Auf der anderen Seite empfiehlt es sich, in der Vorbereitung darüber nachzudenken, wie und wo das Gespräch stattfinden soll. D. h. in der Regel fragen wir die beteiligten Personen, wo und wann es für sie passend ist.
Angaben zu eingesetzten Kommunikationshilfen oder individuelle Übersetzungen und Erklärungen sollten ebenfalls, beispielsweise unter der Überschrift »Unterstützung beim Ausfüllen/Kommunikationshilfen« dokumentiert werden. Auch sollte das Setting, also der Ort des Gespräches bzw. die Anzahl der Gespräche und wichtige Hinweise auf das Setting ergänzt werden.
Praxistipp:
Es empfiehlt sich, am Ende der Vorbereitung alle vorhandenen Informationen einmal dem bio-psycho-sozialen Modell der ICF zuzuordnen.
1.3.2 Durchführung des Bedarfsermittlungsgesprächs
Die Bedarfsermittlung lebt vom gemeinsamen Dialog. D. h. im gemeinsamen Sprechen und Fragen klären wir die relevanten Situationen unter Berücksichtigung der Lebensvorstellung der betroffenen Person. Diese Fragen sollen dabei helfen, Situationen im Alltag, in der freien Zeit und an Wochenenden, auf der Arbeit oder in der Beziehung zu anderen Menschen zu verstehen und beschreiben zu können. Hierbei kann alles benutzt werden, was der betroffenen Person hilft zu sagen, was ihr wichtig ist.
Der Dialog und die Aufgaben der Perspektiven
Das Bedarfsermittlungsgespräch ist ein Dialog zwischen den beteiligten Personen mit ihren jeweiligen Perspektiven. Diese Perspektiven sind gleichberechtigt. Dialog meint hier eine Form der Begegnung. In dieser Begegnung treffen die verschiedenen Perspektiven aufeinander. Diese können durch Sprache oder eine gemeinsame Erfahrung in einer gemeinsamen Situation vermittelt werden, d. h. der Dialog beschränkt sich nicht auf Menschen, die sprechen können. Menschen, die nicht sprechen können, nehmen gleichberechtigt am Gespräch teil. Die fachliche Aufgabe ist in diesem Falle, der Perspektive der betroffenen Person Ausdruck zu verleihen. Anders gesagt, das Bedarfsermittlungsgespräch ist ausgehend von dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe zu gestalten.
»Denn in Wirklichkeit bedeutet Teilhabe, dass ich nicht nur ein Recht auf Teilnahme habe, sondern dass ich auch, um teilnehmen zu können, etwas geben muss. Was ich brauche, ist vielmehr, dass ich auch von mir etwas geben kann, dass ich Bedeutung für Andere habe, nicht immer nur für mich, sondern eben auch für Andere« (Dörner, 2012)
Bedarfsermittlungsinstrumente sollten so aufgebaut sein, dass die Sichtweise der betroffenen Person übergeordnet über die Ordnungskriterien der ICF beschrieben wird. Die Sichtweise der betroffenen Person ist also nicht in einzelne Kapitel oder Lebensbereiche gegliedert, sondern fragt nach ihrer erlebten Perspektive.
Eine ergänzende fachliche Sicht hat in diesem Prozess drei Aufgaben.
1. Sie ist dafür verantwortlich, ein Gesprächssetting zu schaffen, das der betroffenen Person die praktische Möglichkeit eröffnet, ihre Perspektive zu formulieren. D. h. in allen Teilen des Gespräches ist die betroffene Person umfassend und gleichberechtigt einzubeziehen. Die Wahl der Unterstützung und die Gestaltung der Gesprächsatmosphäre stellt eine fachliche Anforderung im Rahmen der Bedarfsermittlung dar.
2. Sie ordnet auf Grundlage der Perspektive der betroffenen Person die Informationen dem bio-psycho-sozialen Modell zu und ergänzt im gemeinsamen Dialog die Perspektive der betroffenen Person fachlich.
3. Das bio-psycho-soziale Modell der ICF bietet lediglich einen Rahmen zur Verständigung über bzw. zur Beschreibung von Situationen. Ein zentraler Gedanke dieses Modells sind Wechsel- und Auswirkungen, die sich im Alltag aus den verschiedenen Informationen ergeben. Diese im Blick zu behalten und so eine plausible Darstellung zu erreichen ist ebenfalls Aufgabe der ergänzenden fachlichen Sicht.
Bei der Darstellung der Perspektiven sollte nachvollziehbar ist, wer welche Sicht auf die besprochenen Situationen hat. D. h. es ist weder ein Widerspruch noch ein Problem, wenn die Beteiligten eine Situation unterschiedlich sehen und einschätzen. Aber dieser Sachverhalt sollte gut und nachvollziehbar dokumentiert sein. Eine Möglichkeit hierzu ist, die unterschiedlichen Perspektiven durch ein Namenskürzel o. ä. kenntlich zu machen.
Teil I: Lebensvorstellungen und Lebenssituation
Um beurteilen zu können, welche Situationen zukünftig erhalten bleiben und welche sich verändern sollen, beginnt man mit den Lebensvorstellungen der leistungsberechtigten Person. Diese bilden den Orientierungspunkt der Bedarfsermittlung, nicht die Schädigungen und Beeinträchtigungen! Denn wenn man nicht weiß, wo man hin will, weiß man auch nicht, was zu tun ist, um dorthin zu kommen.
Diese Wünsche, Ziele und Vorstellungen (Leitziele) sollen allen Beteiligten dabei helfen zu verstehen, was der betroffenen Person wichtig ist. Damit schaffen sie eine Orientierung fürs Gespräch. Die Leitziele stellen die Lebensvorstellungen der betroffenen Person dar. Sie sind nicht zu kommentieren oder zu bewerten. Das bedeutet: Auch Leitziele, die auf Außenstehende fantastisch wirken, sind ernst zu nehmen. Es ist die gemeinsame Aufgabe zu klären, welche Bedeutung hier formuliert ist.
Neben der Klärung der Wünsche, Ziele und Vorstellungen zur Gestaltung des Lebens des Betroffenen wird die derzeitige Situation beschrieben.
Praxistipp:
Wenn es für jemanden einfacher ist zu beschreiben, wie die derzeitige Situation ist und was so bleiben soll, wie es ist, dann kann hiermit begonnen werden.
Leitziele werden durch die leistungsberechtigte Person selbst benannt. D. h. eine Unterstützung bei der Formulierung, so dass die Leitziele die Zukunft positiv beschreiben, oder aber bei der Klärung, was die Äußerung der leistungsberechtigten Person bedeutet, stellt eine Form der Assistenz im Rahmen der Bedarfsermittlung dar.
Читать дальше