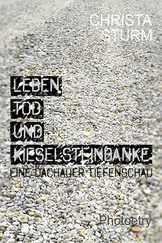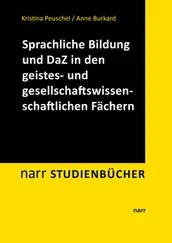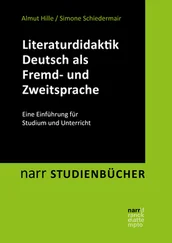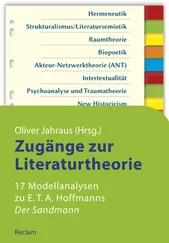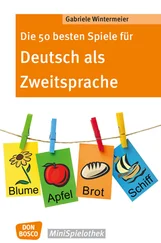Das menschliche Gehirn ist (im Gegensatz zum Geist) physisch und der im Kopf des Körpers gelegene Teil des zentralen Nervensystems; das zentrale Nervensystem umfasst Gehirn und Rückenmark und ist der zentrale Ort, wo alle Informationen des Körpers über neuronale Netzwerke verarbeitet werden.
In den Wissenschaften besteht heute Konsens darüber, dass das menschliche Gehirn dafür verantwortlich ist, nicht nur die körperlichen Informationen zu verarbeiten, sondern auch alle geistigen/kognitiven Prozesse und Strukturen zu regulieren. Uneinigkeit herrscht aber nach wie vor darüber, in welchem Zusammenhang Physisches (inklusive des Gehirns) und Psychisches genau stehen. Embodiment-Theorien geben dafür eine mögliche Beschreibung.
In Embodiment-Theorien spricht man im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses des menschlichen Organismus davon, dass Geist und Körper eine funktionelle Einheit bilden. Damit ist gemeint: Menschliche Kognition benötigt, um sich im Zuge des menschlichen Daseins entwickeln und intelligent arbeiten zu können, über das Gehirn hinaus eine Umwelt, in die das Gehirn eingebettet ist und die den Menschen mit Erfahrungen versorgt.
Ausschlaggebend ist die These, dass der Körper selbst bereits ein Teil der unverzichtbaren Umwelt ist. Über die Sinne wirken nicht einfach Umweltreize auf einen Organismus ein und veranlassen ihn zu bestimmten Denkprozessen und einem Verhalten bzw. zu einer motorischen Reaktion. Kognition findet vielmehr in ständiger Wechselwirkung statt – einerseits mit dem Zustand der äußeren Umwelt, andererseits mit dem Zustand der inneren Umwelt, also mit dem Zustand des Körpers. Dabei spielen für den Ablauf der kognitiven Prozesse, für das, was wir denken, u.a. der Körperausdruck, die Körperhaltung, die Körperspannung und die Emotionen eine wesentliche Rolle. Sowohl die weitere Umwelt als auch der Körper können als Kontrollparameter auf die kognitiven Musterbildungen Einfluss nehmen (vgl. Tschacher 2006: 15, 31; Lakoff & Johnson 1999: 16ff.). Somit konstituiert der Körper also zugleich sowohl ein Medium für Umwelterfahrung als auch selbst eine Erfahrungsquelle .
Wir geben im Folgenden einige Beispiele, um den komplexen wechselseitigen Einfluss von Kognition und allen körperlich-sinnlichen Dimensionen zu illustrieren. Das erste Beispiel betrifft den Zusammenhang von Bewegung, Emotionen und Denken und stammt aus der Studie von Michalak, Rhode & Troje (2015), zitiert in Tschacher (2022).
Bewegung, Emotion und Denken
Wenn wir gehen, tun wir dies in einer bestimmten Gangart, die je nach unserer emotionalen Stimmung variieren kann. Intuitiv naheliegend ist die Auffassung, dass unsere emotionale Stimmung unsere Gangart beeinflusst. Wenn wir fröhlich sind und uns fröhlich fühlen, gehen wir mit einer aufrechteren Körperhaltung und ‚beschwingter‘, als wenn wir traurig sind. Letzteres führt eher dazu, dass wir die Schultern hängen lassen, gebeugter gehen etc. Michalak, Rohde & Troje (2015) konnten in ihrer experimentellen Studie zeigen, dass auch die andere Einflussrichtung möglich ist: Die Gangart kann unsere emotionale Stimmung und damit einhergehend unsere sprachliche Erinnerungsleistung beeinflussen.
So funktionierte das Experiment: Die gesunden, erwachsenen Proband:innen mussten zunächst eine Liste, die Wörter mit positiver und negativer Bedeutung enthielt, auswendig lernen. Anschließend sollten sie auf einem Fließband gehen und wurden durch ein Feedback über technische Hilfsmittel dazu gebracht, zwei verschiedene Gangarten umzusetzen: Die eine Gangart entsprach einem ‚fröhlichen Gehenfröhliches Gehen‘, die andere einem ‚traurigen Gehentrauriges Gehen‘. Anschließend an die Phase des Gehens wurde erneut die zuvor auswendiggelernte Wörterliste abgefragt. Die Erinnerungsleistung der Proband:innen mit der fröhlichen Gangart unterschied sich systematisch von der Gruppe mit der traurigen Gangart. Während Erstere sich besser an die Wörter mit einer positiven Bedeutung erinnerten, erinnerten die ‚traurig Gehenden‘ mehr negative Wörter.
 Abb. 2.3:
Abb. 2.3:
Unterschiedliche GangartenGangarten („fröhlich“, „traurig“)
Ähnlich wie die Gangart scheint auch Gestik Einfluss auf kognitive Prozesse nehmen zu können. Die folgenden Beispiele stammen von der Forschergruppe um Goldin-Meadow (siehe in der Zusammenfassung auch Zepter 2013: 273ff.). Sie zeigen nicht nur, dass Gestik eine Sprecherin bei einer kognitiven Herausforderung konstruktiv unterstützt; sondern auch, dass die Ausführung von Gesten unmittelbar die Gedankenführung beeinflussen kann.
Gestik und Denken, Gedankenführung
Zuerst zum Aspekt der Unterstützung (vgl. Goldin-Meadow et al. 2001): In einem Test lösten Kinder (von im Durchschnitt knapp zehn Jahren) und junge Erwachsene (im Hochschulalter) zunächst selbstständig altersgerechte Mathematikaufgaben. In einem zweiten Schritt sollten die Testpersonen eine Reihe von vorgelegten Testeinheiten memorieren – die Kinder Wörter, die Erwachsenen Zahlen. Anschließend wurden sie gebeten, mündlich zu erklären, mit welchen Teilschritten sie die Mathematikaufgaben gelöst hatten. Letzteres geschah unter zwei Bedingungen: Einmal (a) waren bei den mündlichen Erläuterungen spontane HandgestenHandgesten erlaubt, das andere Mal (b) mussten die Hände still gehalten werden.
Nach der Erklärungsperiode konnten nun generell sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen signifikant mehr von den zuvor memorierten Testeinheiten eben dann erinnern, wenn sie bei der zwischengeschalteten Aufgabenerläuterung spontane Gesten hatten ausführen dürfen. In beiden Gruppen waren diese Resultate unabhängig von dem jeweiligen mathematischen Wissen der Testpersonen robust. Das heißt, der GestenvollzugGestenvollzug verbesserte die spätere Erinnerungsleistung unabhängig davon, wie leicht oder schwer die Testperson die Mathematikaufgabe ursprünglich hatte lösen können. Offenbar entlasten die Handgesten die Sprecherin/den Sprecher bei einer mündlichen Erklärungsaufgabe in Hinsicht auf die kognitiven Ressourcen, so dass im Anschluss mehr Ressourcen für die Erinnerungsaufgabe zur Verfügung stehen (vgl. Goldin-Meadow et al. 2001: 521).
Darüber hinaus konnten Broaders et al. (2007) nachweisen, dass die Ermutigung zur Ausführung von Handgesten bei Grundschulkindern die Wahrscheinlichkeit erhöht, zuvor ungelöste Mathematikaufgaben schlussendlich zu bewältigen. In der betreffenden Studie galt es, Mathematikaufgaben an der Tafel selbstständig zu lösen und dabei gleichzeitig die gewählte Strategie zu erläutern. Dabei zeigte sich, dass Kinder, die an den gestellten Aufgaben zuerst scheiterten, von einem zusätzlichen Gesteneinsatz durchschlagend profitierten. Offensichtlich setzte der Weg über die Gestik weitere Kreativität frei bzw. ermöglichte es, zuvor unzugängliches Wissen verfügbar zu machen und neue Problemlösungsstrategien anzuwenden.
Ein weiteres Beispiel von Beilock & Goldin-Meadow (2010) belegt, dass das Potenzial von Gesten so weit greift, dass ihre Ausführung unmittelbar den Aufbau kognitiver Repräsentationen beeinflussen kann. D. h., hier zeigte die experimentelle Untersuchung, dass nicht nur der Handlungsvollzug, sondern auch Gestik relevante Aktionsinformationen zu den kognitiven Repräsentationen, die Personen von einer betreffenden Handlungsaufgabe haben, hinzufügt. Mit anderen Worten, die Beschreibung einer Handlungsaufgabe qua Gestik verändert unser Denken über die Aufgabe. Ist die ergänzte Information kompatibel mit den für die Aufgabe erforderlichen Teilhandlungen, verbessern sich im Anschluss weitere Durchführungen der Aufgabe; ist sie es nicht, so tritt eine Verschlechterung ein.
Читать дальше
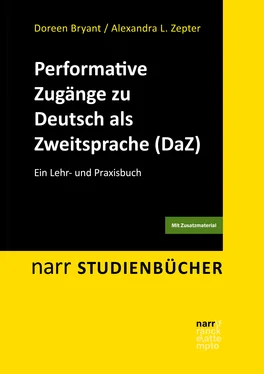
 Abb. 2.3:
Abb. 2.3: