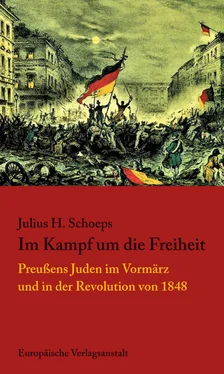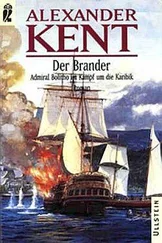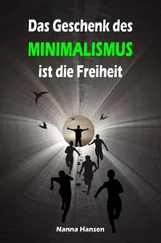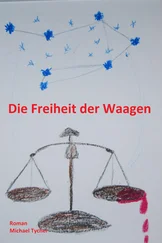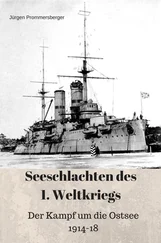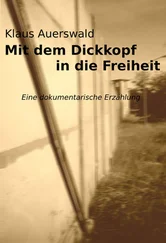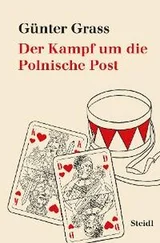Meist waren es Männer, die sich, beeinflusst vom Optimismus der Aufklärung und vom Vernunftdenken, in diesen Jahren aktiv politisch betätigt und zu freiheitlichen und demokratischen Idealen bekannt haben. Aber auch Frauen, vereinzelt jedenfalls, sympathisierten mit diesen Idealen. Bei ihnen geschah das allerdings mehr im privaten Rahmen, in der Familie und bei Zusammenkünften mit gleichgesinnten Freunden und Freundinnen.
Existierende Tagebucheintragungen, Briefe, aber auch Gedichte, Romane und andere Beschreibungen allgemeiner Zustände lassen erkennen, wie diese Männer und Frauen gedacht, gefühlt und sich in bestimmten Situationen verhalten haben. Sieht man sich ihre Lebensverläufe etwas genauer an, dann kommt man nicht umhin, festzustellen, dass dabei unterschiedliche Antriebsmomente und Motive eine Rolle gespielt haben.
Der aus Lissa, dem heutigen Leszno, stammende Ludwig Kalisch war beispielsweise einer der jüdischen Schriftsteller, die mit dem Gelehrten Leopold Zunz die Überzeugung teilten, dass es einen Zusammenhang zwischen messianischer Verheißung und bürgerlicher Revolution gäbe. Kalisch, ein heute weitgehend vergessener 1848er, war fest davon überzeugt, dass die Juden keinen Extra-Messias benötigten, sondern dass der Messias nur als Befreier für die ganze Menschheit erscheinen könne. „Dem heutigen Juden“, bemerkte Ludwig Kalisch in seinen „Bildern aus meiner Knabenzeit“, „ist jeder Mensch ein Messias, der für die Freiheit der Völker, für das Wohl der Menschheit wirkt, und sieht das gelobte Land da, wo die Freiheit waltet“.
Schlüsselfiguren, die so dachten wie Leopold Zunz und Ludwig Kalisch, verkörperten gewissermaßen die jüdische Vorhut eines neuen modernen und aufgeklärten Denkens. Aber noch waren sie damals Ausnahmen. Die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung in Preußen und in anderen deutschen Staaten war nach wie vor traditionell eingestellt und stand revolutionären Experimenten misstrauisch und mit Vorbehalten gegenüber. Man war bemüht, nicht aufzufallen und verhielt sich dementsprechend.
Zunächst waren es nur vereinzelte engagierte Vertreter, die sich politisch aktiv zu betätigen begannen und revolutionäre Ansichten vertraten, wie etwa der Hamburger Jurist Gabriel Riesser und der aus Königsberg stammende Arzt Johann Jacoby. Die „Judenfrage“, die die christliche, aber auch die jüdische Bevölkerung beschäftigte, wurde von ihnen nicht als eine religiöse, sondern in erster Linie als eine soziale und politische Frage verstanden.
Riesser, Jacoby und andere Demokraten jüdischer Herkunft gingen davon aus, dass die „Judenfrage“ sich keinesfalls von selbst erledigen würde, sondern dass erst mit der Durchsetzung freiheitlicher Prinzipien und demokratischer Verhältnisse die Benachteiligung und Zurücksetzung der jüdischen Bevölkerung aus der Welt geschafft werden könne. Dazu haben sie sich in Wort und Schrift immer wieder geäußert
Was die Einstellung und Sichtweisen zu den damaligen politischen Entwicklungen betraf, gab es durchaus auch Unterschiede. Das zeigt sich etwa bei einer Reihe von bürgerlichen Liberalen jener Zeit, bei Männern wie Gabriel Riesser und Johann Jacoby, aber auch später bei Politikern jüdischer Abstammung wie Heinrich Bernhard Oppenheim, Eduard Lasker und Ludwig Bamberger.
Die Letzteren haben sich in der nach-revolutionären Epoche, im Vorfeld der Reichsgründung, politisch betätigt, zeitweise radikal denkend, allerdings, das sei ausdrücklich vermerkt, nicht so radikal wie der Gesellschaftstheoretiker und Protagonist der Arbeiterbewegung Karl Marx, der schon früh eine Konzeption der „Judenfrage“ vertrat, die in der These gipfelte, die gesellschaftliche Emanzipation der Juden sei die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum.
Die Ausführungen im vorliegenden Buch knüpfen in vielem an die Diskussionen an, die auf der Konferenz „Juden im Vormärz und in der Revolution 1848“ geführt wurden, welche ich zusammen mit dem Historiker Walter Grab vor vier Jahrzehnten 1982 in der Evangelischen Akademie in Mülheim/Ruhr ausgerichtet habe. Bei den Planungsgesprächen im Vorfeld zu dieser Konferenz gingen wir damals davon aus, dass nach wie vor erhebliche Interpretationsspielräume bestünden, was den innerjüdischen Einfluss auf die damaligen politischen Entwicklungen betreffe.
Wie, so fragten sich denn auch die Teilnehmer der Konferenz (u.a. Jacob Allerhand, Micha Brumlik, Arno Herzig, Jacob Toury, Zwi Rosen, Helmut Hirsch, Michael Riff, Konrad Feilchenfeldt, Margarita Pazi, Shlomo Na’aman, Susanne Miller und Michael Werner), haben bekannte und weniger bekannte jüdische Dichter, Publizisten, Politiker, Männer wie Frauen, diesen Prozess in den Jahren 1830 bis 1870 verarbeitet, und wie sind sie mit den Identitätsproblemen, die sich ihnen zur damaligen Zeit stellten, fertig geworden?
Mehrheitlich waren die Konferenzteilnehmer damals der Ansicht, die Werke, Schriften und Äußerungen der in den Vorträgen behandelten Dichter, Publizisten und Politiker würden wesentliche Aufschlüsse geben über die Identitätskonflikte der deutsch-jüdischen Akteure in jenen spannenden, revolutionären Jahren. In den Debatten wurde deutlich, dass man doch etwas mehr als bisher bekannt über die politischen Entwicklungen des Zeitraums von 1830 bis 1870 erfahren kann, jenen spannenden Zeitraum, den Jacob Toury zutreffend die „Formationsperiode des deutschen Judentums“ genannt hat.
Was uns damals in den Debatten besonders bewegte, war die Frage, ob es nicht vielleicht doch so etwas wie ein besonderes Verhältnis der Juden zur Demokratie gebe. So wurde diskutiert, ob das Streben mancher Juden nach demokratischen Verhältnissen nicht vielleicht symptomatisch und repräsentativ für die jüdische Bevölkerung in den Jahren zwischen 1830 und 1870 war. Eine überzeugende Antwort auf diese Frage haben wir damals allerdings nicht gefunden.
Auf besagter Konferenz von 1982 wurden eher Vermutungen geäußert, aber keine Schlussfolgerungen gezogen, die neue Erkenntnisse gebracht und neue Ansätze zur Folge gehabt hätten. Einiges spräche dafür, so argumentierten einzelne Konferenzteilnehmer, dass die Vertreter der jüdischen Bevölkerung eher dem sozialen und politischen Wandel zugeneigt gewesen seien als ihre christlichen Mitbürger. Es war die Zeit, in der in der Geschichtswissenschaft sozioökonomische Fragestellungen die Identitätsfragen überlagerten.
Sollte es tatsächlich eine besondere Affinität zwischen Judentum und Demokratie geben, dann dürfte das, so meinte man, damit zusammenhängen, dass die Juden sich von den sozioökonomischen Umwälzungen mehr versprochen haben als ihre christlichen Mitbürger, die in Teilen zugegebenermaßen zwar ebenfalls für demokratische Rechte eintraten, aber mit den Forderungen der Juden nur wenig anzufangen wussten. Zumeist waren es antijüdische Vorurteile, die es verhinderten, es geradezu unmöglich machten, sich mit den Forderungen der Juden unbefangen zu solidarisieren.
Die damals geführten Diskussionen haben mich bis heute nicht losgelassen. Zahlreiche Bücher und Aufsätze, die ich in den nachfolgenden Jahren veröffentlichte, kreisten immer wieder um die damals in der Evangelischen Akademie in Mülheim/Ruhr behandelten Themen und Fragestellungen, vor allem darüber, welche Bedeutung der Vormärz und die Revolution 1848/49 und die dort erhobenen Forderungen für die preußisch-jüdische Beziehungsgeschichte hatten und ob Jüdinnen und Juden in Preußen dabei eine ganz eigene, spezifische Rolle spielten.
Es sind keine wirklich neuen Entdeckungen und Forschungsergebnisse, die hier in den folgenden Ausführungen vorgestellt werden, vielmehr wird bereits Erarbeitetes zusammengeführt und kontextualisiert, wodurch sich bisher unbeachtete Blickwinkel auftun mögen. Das eine oder andere mag für den Leser tatsächlich „neu“ sein, worauf es mir aber weniger ankommt. Mir geht es in erster Linie darum, damalige Verhaltensmuster, Positionierungen und Aktivitäten der jüdischen Bevölkerung zu beschreiben und in den historischen Zusammenhang einzuordnen.
Читать дальше