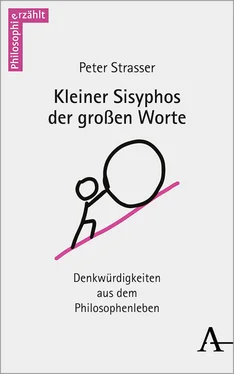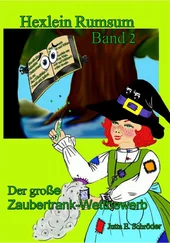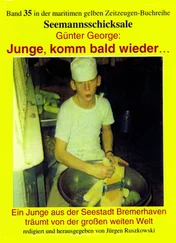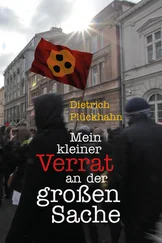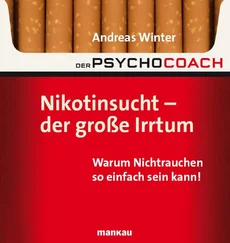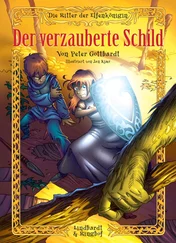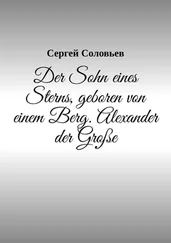Da ich zu begreifen beginne, dass Streber entweder vollkommen verrückt oder bloß ein durchschnittlich verwirrter Student der Philosophie ist, der von seinem Psychiater vollkommen verrückt gemacht wird, sage ich mit gespielter Leichtigkeit: »Natürlich verstehe ich das.« Da sagt Streber: »Wie wäre es, wenn ich morgen in Ihrer Vorlesung versuchen würde, für Sie den anderen Knopf zu drücken?«
Am nächsten Tag betrete ich den Hörsaal ein paar Minuten zu früh. Einige Studenten sitzen bereits herum. Statt aber wie üblich vor sich hin zu dösen, schauen sie nach vorne und wissen nicht, was sie von dem zu halten haben, das sich dort ereignet. Dort steht einer und werkelt an den Knöpfen herum, sodass die beiden großen Tafeln ununterbrochen auf- und abfahren. Aus den Gesten der teils erheiterten, teils stellvertretend verlegenen Zuschauer lässt sich leicht eine Frage ablesen: Ist der da vorne verrückt?
Wie sollten sie wissen, dass Streber mir bloß zeigen will, was es bedeutet, den anderen Knopf zu drücken?
Seit jenem Auftritt Strebers an der Tafel des Hörsaales, in dem ich meine Vorlesung zur Transzendenz des Ego halte, sind Wochen vergangen. Die Zimmerkamelie auf dem Fensterbrett meines Wohnzimmers ist verwelkt. Draußen riecht es bereits nach Schnee, wenn der Wind über das Bergland in den Kessel der Stadt einweht. Ich erinnere mich, wie ich auf Streber zugegangen bin, der an den Knöpfen der Tafel herumwerkelte, um den anderen Knopf zu drücken. Plötzlich hatte mich ein wildes Mitleid für diesen jungen Menschen gepackt, während sich in den Bänken hinter ihm seine Kollegen und Kolleginnen halb erstaunte, halb belustigte Blicke zuwarfen. Ich eilte auf ihn zu, er schien mich nicht zu hören. Als ich neben ihm stand, eingehüllt in einen Tablettennebel, flüsterte ich ihm ins Ohr: »Hören Sie doch auf, Streber, so hören Sie doch auf!«
Da drehte sich Streber um. Man kann das nicht anders sagen: Er drehte sich um im Schweiße seines Angesichts. Er schaute mir fest in die Augen wie jemand, der sich vorgenommen hat, seinem Richter in die Augen zu schauen, und sagte: »Es hilft nichts.« Ich spürte ein Verlangen, ihn in meine Arme zu nehmen, an mich zu drücken. Zugleich spürte ich meine Hände an meinem Körper nach unten hängen. Was konnte ich noch sagen? Ich musste dem Gescharre und Gewitzel hinter mir ein Ende bereiten. Ich sagte also zu Streber, dass ich nicht ernsthaft gewollt hätte, er möge sich an der Tafel zu schaffen machen – der »andere Knopf« sei, darüber brauchten wird beide uns wohl nicht eigens zu verständigen, ein Gleichnis, oder? Ein Gleichnis!
Ich sagte zu Streber, er wisse so gut wie ich, dass es unmöglich sei, den Knopf in einem Gleichnis an einer realen Tafel zu finden, um ihn als ersten Knopf zu drücken, zumal der »erste Knopf« auch bloß ein Knopf im Gleichnis sei. Streber schaute mich an, als ob ich gar nichts gesagt hätte. Ich sagte also: »Haben Sie mich verstanden?« Und er sagte: »Natürlich, aber es hilft nichts.« Während ich jetzt, Wochen später, in meinem Dienstzimmer vor einem Packen Wiederholungsklausuren sitze, die möglichst schnell korrigiert sein wollen, denke ich an Streber.
Er sagte: »Es hilft nichts«, wandte sich ab und ging. In den Wiederholungsklausuren, die vor mir auf dem Tisch liegen, geht es um Politeia, Buch VII, 514a–541b. Dort findet sich Platons Höhlengleichnis. Wieder ertappe ich mich bei der Frage, die ich mir schon oft gestellt habe: Glaubte der Philosoph wirklich, was er zu wissen glaubte, und daher seine Zuhörerschaft glauben machen wollte? Glaubte Platon daran, dass die vielgestaltige Welt der Sinne nichts weiter als eine Art Höhle sei, in der wir, die Gemeinsterblichen, unser ganzes Leben lang ausharren müssen, gefangen im Schattenreich, fern der Wahrheit? Glaubte er, dass die Befreiung darin bestünde, die sinnliche Fessel abzuwerfen, um das volle Licht der Wahrheit zu schauen? Glaubte Platon allen Ernstes, dass es wirklichkeitsnäher und beseligender sei, die Idee einer Frühlingswiese in Gedanken zu erfassen, statt die Frühlingswiese in ihrer frischen Pracht, ihrer bunten, summenden, duftenden Zartheit zu erleben? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Meine Studenten (einschließlich meiner Studentinnen) offenbar schon. Während ich ihre Antworten lese, habe ich das ungute Gefühl, einer Kulissenschieberei aus Prüfungskalkül beizuwohnen. Je nach Talent und Laune wird Platons Höhlengleichnis wiedergegeben, als ob es sich dabei um eine der vielen Möglichkeiten handelte, die menschliche Situation innerhalb der Welt zu betrachten. Jawohl, die meisten von uns sind blind, fast blind, denn sie sehen nicht, dass die bunte Frühlingswiese bloß ein fahler Schatten ist, der, jawohl, kaum eine Ahnung vom herrlichen Licht der Ideen und ihrer abstrakten Wahrheit vermittelt. Das schreiben meine Studenten, Platon referierend, ohne sich zu fragen, wie es jemandem gehen muss, der so etwas behauptet.
Was beunruhigt Platon derart, dass er in der blühenden Frühlingswiese nichts sehen will als eine lichtlose Illusion im Kerker der Körperwelt? Wenn meine Studenten (zu zwei Drittel Studentinnen) daran nichts Beunruhigendes entdecken, dann wohl deshalb, weil sie das, was ihnen der Philosoph eröffnet, nicht ernst nehmen: nicht nehmen als eine Doktrin, die ihr Leben von Grund auf ändern sollte. Fühlte sich Platon, auf einer sonnigen Frühlingswiese stehend, tatsächlich in einer Höhle eingeschlossen, abgeschnitten von der Sonne des Lebens?
Im Großen und Ganzen bin ich, soweit man mir erzählte, ein normales Kind gewesen. Allerdings machte ich mir, seit ich fähig war, mir über Dinge Gedanken zu machen, »ungesunde Gedanken« – meine Großmutter, bei der ich aufwuchs, nannte das so. Sie war eine bodenständige Frau. »Tot ist tot«, pflegte sie zu sagen, wenn ihr jemand mit dem Tod kam, wobei sie ihren Standpunkt gerne unterstrich, indem sie hinzufügte: »… und Schnaps ist Schnaps.« Der Tod war für sie eine handfeste Sache. Worüber sie sich Gedanken machte, war der Himmel. Es gehört zur Bodenständigkeit des Lebens, dass man einmal glücklich sein möchte; und dass man hofft, es möge, nachdem man gestorben ist, nicht aus sein für immer. »Tot ist tot« gilt nicht für das Leben danach.
Der Satz »Tot ist tot« löste in mir jedoch das Gegenteil von dem aus, was er auslösen sollte. Statt für mich das Thema »Tod« zu erledigen, wirkte jener Satz wie ein Mantra, eine dieser Gebetslitaneien, die man sich immer wieder und wieder vorsagt, bis man das Gefühl hat, durch die Begriffe zu starren. Die buddhistische Nonne Patacara hat gesagt, es komme im Leben des Meditierenden darauf an, den Docht aus der Kerze zu ziehen. Was bleibt, sei das Leuchten. Das Leuchten blieb mir nie. Was mir blieb, war ein inneres, ein gebanntes, ein verkrümmtes Starren auf dieses Wort: Tod .
Schon als Schulkind erwachte ich mit dem Wort »Tod«, durch das ich hindurchzustarren versuchte. Aber dort, auf der anderen Seite des Wortes, war nichts. Ich starrte in meinen Gedanken auf das Wort, und das Wort – Tod, Tod, Tod – schien mir manchmal, bevor ich meine Beine aus dem Bett schwang, alles zu sein. Das Wort schien mich aufzusaugen, umso gründlicher, je weniger sich hinter ihm etwas auftat.
Eines Morgens sagte ich zu meiner Großmutter: »Wenn der Tod nichts ist, dann bin ich auch nichts.« Damit meinte ich wohl, dass, wenn das Wort »Tod« für mich undurchdringlich bliebe, ich in dem rätselhaften Wort – »Tod«, »Tod«, »Tod« –, das wie ein blindes Fenster auf ein Nichts dahinter deutete, verschwinden müsste, keineswegs mit Haut und Haaren, aber als das denkstarre Wesen, als welches ich mich innerlich um dieses Nichts krümmte. Das war ein typischer Fall für das, was meine Großmutter »ungesunde Gedanken« nannte.
Читать дальше