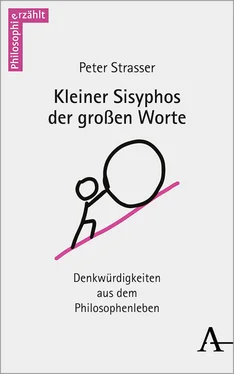Als im Jahre 2004 der Tsunami in Indonesien fast eine Viertelmillion Todesopfer forderte, war hierzulande zwar nicht offen von einem Strafgericht Gottes die Rede. Aber der eine oder andere Kirchenfürst fühlte sich trotzdem bemüßigt, darüber zu predigen, dass Gott seinen Geschöpfen – uns – eine schmerzhafte Lehre erteilen wollte, damit wir wieder auf den rechten Weg des Lebens und vor allem des Glaubens zurückfänden. Nun, aus dem Kopfschütteln der Medien über solche Erklärungsversuche haben die Glaubensautoritäten gelernt. Die Zeiten, in denen ein mittelalterlicher Geist praktisch alle Menschheitsplagen, ob regional oder weltweit, als Strafgerichte Gottes zu interpretieren wusste, sind endgültig vorbei.
Nach den Gründen für diesen Wandel brauchen wir nicht zu suchen, sie sind offenkundig. Wichtiger ist es, klar zu erkennen, dass sich im Laufe der Zeiten das Glaubensgefühl selbst grundlegend geändert hat. Seit dem 18. Jahrhundert hat dazu die Theodizee, das heißt der bemüht-aufgeklärte, rational argumentierende Versuch maßgeblich beigetragen, unsere Welt trotz all der Übel und des Bösen in ihr als »die beste aller möglichen« zu rechtfertigen (G. W. Leibniz). Der Versuch scheiterte; er belastete Gott. War er, der Weltschöpfer, womöglich ein böswilliger Dämon? Kümmerte ihn das Schicksal seiner Geschöpfe, hatte er sich von seiner Kreation etwa abgewandt? Oder war Gott womöglich nur eine Fiktion überhitzter, verzweifelter Gehirne, die sich einen Übervater zurechtreimten?
Was die Verächter der Religionen und Heilsgeschichten, die »religiös Unmusikalischen« (Max Weber) nicht wahrhaben, indem sie auf die Glaubensschrumpfung im säkularisierten Westen hinweisen, ist die Evolution des religiösen Weltbildes. Während die Kritiker nur noch verschollene Gewissheiten und liturgische Leerläufe sehen, wirkt bei vielen derer, welche sich eine Existenz außerhalb der religiösen Lebensform kaum vorstellen können, die Symbolkraft der heiligen Schriften und ihrer Botschaft nach innen. Die Verinnerlichung des Glaubens geht einher mit der tröstlichen Gewissheit, dass, bei aller Unwissenheit über den höheren Sinn der massenhaft umlaufenden Übel, wir doch eingebettet sind in einen »Kosmos« – eine Weltordnung, von der es im biblischen Schöpfungsbericht, der Genesis, lapidar heißt, sie sei »gut«.
Im Zentrum des Glaubens wirkt ein existenzielles Paradox. Der religiöse Mensch hat sich ohne Wenn und Aber der Fürsorge Gottes überantwortet. Wittgenstein litt zeitlebens darunter, nicht in den Kreis des fraglosen Glaubens eingelassen zu werden. Das Denkgenie hielt die Ethik für mystisch und daher im Grunde für unaussprechbar. Deren oberste Maxime schien, in Worte gefasst, bloß hässlichen Unsinn zu ergeben: »Was immer passiert, mir kann nichts passieren.«
Im bäuerlichen Volksstück des österreichischen Dichters Ludwig Anzengruber, betitelt: Die Kreuzelschreiber (1872) – das sind des Lesens und Schreibens Unkundige –, wird diese Maxime ausgesprochen. Sie hat den Zuhörer Wittgenstein eine »Einsicht« beschert, an welcher er sein Leben lang festhielt: Der wahrhaft Gläubige empfindet, indem er ein gottgefälliges Leben zu führen sucht, eine Art absoluter Geborgenheit im Schlechten, deren Quelle die unbedingte Liebe Gottes ist.
Kürzlich erst erhielt ich freundliche Zeilen von einem Franziskaner, der auf einige meiner gelegentlichen Bemerkungen zur drohenden Apokalypse unserer zivilisierten Welt reagierte: »Wir leben letzten Endes nicht aus der Dramatik der Apokalypse, auch wenn ich diese für wichtig und wesentlich halte, sondern aus dem Staunen über eine sich verschwendende göttliche Liebe. Auch wir wollen lieber Heilung und Problemlösung. Aber in der Covid-Krise erinnern wir uns vielleicht neu an das Wesentliche der Liebe, die hinter allem steht.«
Dem entsprechen die christlichen Ideale der Caritas und Misericordia, der tätigen Nächstenliebe und Barmherzigkeit gegenüber den Armen und Elenden. Dabei handelt es sich um das Bemühen, dem Schöpfungswollen gerecht zu werden. Alles Weitere – das ist wohl der glaubensprofunde Grund für die Zurückhaltung der Kirche mit »Erklärungen« zur Pandemie – übersteigt das menschliche Fassungsvermögen. Man muss dieser Demut vor dem Unfassbaren nicht beitreten; indes, man sollte sich über sie auch nicht mokieren. Denn sie ist mindestens ebenso fundamental für unsere humane Verfasstheit – für den Sinn des Lebens – wie das Streben, unserem eigenen Leben Sinn zu geben, indem wir uns bemühen, das individuelle Leid zu lindern und die grassierende Welt-Not zu bekämpfen.
Finis philosophiae, Ende der Philosophie.
Und ihr Beginn …
I
Wie es ist,
ein Philosoph zu sein
Die folgende Geschichte habe ich schon öfter erzählt, an verschiedenen Orten und im Rahmen unterschiedlicher Foren. Ich erzähle sie hier noch einmal, weil in ihr vieles von dem rumort, wodurch sich meines bescheidenen Erachtens ein Philosophenleben auszeichnet – nämlich durch das eigentümliche Schwanken zwischen Tiefe und Clownerie.
Um Wahrhaftigkeit bemühte Philosophie birgt einen begriffslosen Überschuss, der an die Oberfläche des Wortes drängt. Er will mitgeteilt sein. Dabei entsteht für die unberührte, profane Umwelt leicht der Eindruck, das philosophierende Subjekt habe nicht mehr – wie es im Volksmund treffend heißt – »alle Tassen im Schrank«.
Mag sein. Doch die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, die in den Sphären der Kunst verschwimmend und breit ist, schrumpelt in der Philosophie, bei aller Quälerei der Denkungsart; was übrigbleibt, ist meist ein kleiner Sisyphos der großen Worte.
Am Schluss sucht den denkerisch Gequälten eine »Erleuchtung« heim, die er bei sich womöglich als Offenbarung verbucht. Und dabei war es nur ein Schäumen seines überhitzten Gehirns, ein Aufwallen seiner Neuronen-Netzwerke … aber wer weiß, vielleicht verbirgt sich dahinter ja ein Geheimnis, das der Profanierung widersteht?
Ich will also von einem philosophischen Sisyphos berichten, der in meiner Geschichte »Streber« heißt. Er litt darunter, im Mitmenschen, dem Alter Ego, oft nicht »das lebendige Wesen« spüren zu können, während er den Verdacht hegte, kein Ego zu haben, gefangen zu sein in solipsistischer Ichlosigkeit.
Und dabei ist es wohl möglich, dass ich mir selbst begegnete – in einem langen Moment, als ich gerade dabei war, um eine entfremdete Ecke meiner Existenz zu biegen.
Es gibt solche Tage. In der Nacht hat ein eisiger Wind die Stadt blank gefegt, und nun, am Morgen, steht der Himmel blau im Fenster. Auf dem Fensterbrett schiebt sich das erste Blütenrot durch die harten, kugeligen Knospen der Zimmerkamelie. Ich aber sitze beim Frühstückstisch und denke an die Transzendenz des Ego. Die Folge: Morgengrausen.
Später am Tag dann meine Vorlesung zur Transzendenz des Ego. Hinterher stürmt ein Student in meine Sprechstunde und schaut mich herausfordernd an. Er habe, sagt er, kein Ego, daher – und dabei kommt sein Gesicht dem meinen so nahe, dass ich den Eindruck habe, er will durch meine Augen hindurchstarren – habe er auch nichts, was transzendent sein könnte. Er ist da, sagt er, einfach da: »Und damit werden Sie leben müssen!«
Er riecht nach Tabletten, ich will ihn fragen, ob er wegen seines Problems einen Arzt konsultiere, stattdessen sage ich bloß: »Ich kann Sie gut verstehen.« Da beginnt er, über das ganze Gesicht zu strahlen, es macht ihn glücklich, so einfach verstanden zu werden, statt in eine quälende Diskussion über sein fehlendes Ego und sein totales Dasein eintreten zu müssen. Er sagt noch – wozu kein Anlass besteht, es ist ja meine Sprechstunde –: »Entschuldigen Sie die Störung«, und schon ist er wieder draußen bei der Tür.
Читать дальше