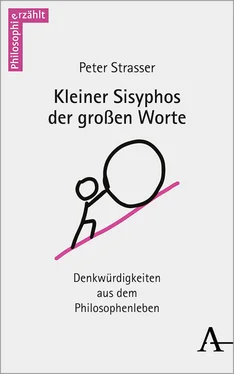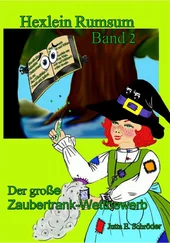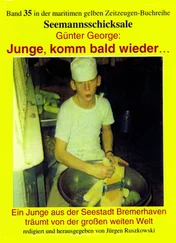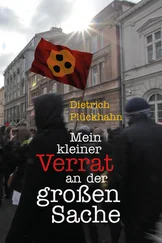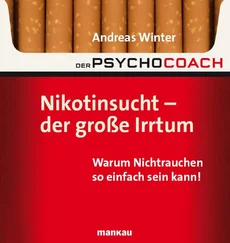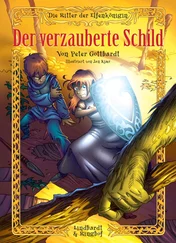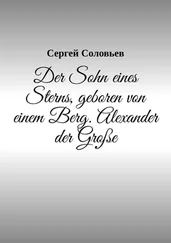Tags darauf hat das Wetter umgeschlagen. Nebel, Regen, Smog. In meinem Dienstzimmer habe ich das Licht brennen. Das kann man von draußen durch die Oberlichten sehen. Ich habe keine Sprechstunde, dennoch tritt nach kurzem Anklopfen, das mir nicht einmal die Möglichkeit lässt, mich abwesend zu stellen, der Student ein, der behauptet, kein Ich zu haben. »Darf ich mich setzen?«, fragt er und sitzt bereits. »Aber bitte«, sage ich und rieche Tabletten.
Ich will ihn fragen, ob es ihm gut gehe, doch bevor ich den Mund aufmachen kann, sagt er: »Mir geht es gut.« Während ich mich zu ihm setze – mir fällt nichts Besseres ein, ich kann ihm nicht einfach die Tür weisen (Tablettengeruch!) –, ist mein Kopf leer; ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich das Gespräch beginnen soll. Er würde mir vermutlich ohnehin zuvorkommen und die Frage, die ich ihm stellen möchte, beantworten, bevor ich anfange, sie überhaupt auszusprechen. So sitzen wir eine Zeitlang da und schauen uns an.
Dann beginne ich ihm eine Geschichte zu erzählen, die mir plötzlich einfällt. Sie passt zu uns beiden, wie wir dasitzen und einander anschauen. Ich erzähle ihm, dass ich an der großen, zweiteiligen Tafel des Hörsaales, in dem ich meine Vorlesung zur Transzendenz des Ego halte, immer den falschen Knopf erwische, wenn ich versuche, den vorderen Teil der Tafel nach oben zu bewegen, sobald ich ihn vollgeschrieben habe. Immer. Immer bewegt sich der hintere Teil nach oben, was komplett sinnlos ist.
Das brachte mich eines Tages auf die Idee, meinem Auditorium, das mein Treiben an der Tafel stets belustigt verfolgte, regelrecht feierlich anzukündigen, ich würde von nun an, statt auf den Knopf zu drücken, den zu drücken ich mich bereits entschlossen hatte, immer auf den anderen drücken: Das müsste, da ich zunächst ja immer den falschen Knopf drückte, dann immer der richtige sein. »Ich habe«, sagte ich also, »mich soeben entschlossen, von diesen beiden Knöpfen hier den linken zu drücken, also drücke ich jetzt den rechten …«
»Ich war damals dabei«, sagt mein Gegenüber, »Sie haben den richtigen Kopf gedrückt.« Jetzt habe ich ihn, denke ich mir, und schaue aus dem Fenster, um mir meinen kleinen Triumph nicht anmerken zu lassen. Draußen ist die Welt fast verschwunden. Der Nebel hat alles weggepackt. Oder ist es bloß die Lustlosigkeit der Dinge, sich zu zeigen? Ungesunde Gedanken, denke ich, das muss der Tablettengeruch sein. »Ich habe den falschen Knopf gedrückt«, sage ich. »Und das«, sagt mein Gegenüber, »war in gewissem Sinne der richtige.«
Streber, denke ich. Strebergeruch. Der Streber weiß die Pointe schon im Voraus. Falls da eine Pointe ist, weiß er sie schon im Voraus.
»Wenn es wahr ist«, sagt der Streber, »dass man zuerst immer den falschen Knopf drückt, dann hilft es nichts, sich vorzunehmen, den ersten Knopf, den zu drücken man sich bereits entschieden hat, nicht zu drücken. Denn dann ist der erste Knopf, den man drückt, eben der, den zu drücken man sich erst entscheidet, nachdem man sich entschieden hat, den Knopf, den zu drücken man sich bereits entschieden hatte, nicht zu drücken. Das ist dann eben der erste Knopf, den man drückt, und daher – weil der erste Knopf, den man drückt, immer der falsche ist – nicht der richtige, sondern der falsche. Und daher «, fügt der Streber nun seinerseits mit verhaltenem Triumph hinzu, »in gewissem Sinne doch der richtige …«
Schön, denke ich, er hat zwar kein Ich, dafür ist er nicht auf den Kopf gefallen; ein dialektisches Talent. »Übrigens, wie heißen Sie, wenn ich fragen darf?«, frage ich, was keine Beleidigung ist, denn ich kann mir nicht die Namen aller meiner Studenten, die zu Hunderten in meinen Vorlesungen sitzen, auswendig merken. »Streber«, sagt er.
Da muss ich lachen, obwohl ich mir hätte denken können, dass ein Streber nicht so viel Selbsteinsicht besitzt, sich selbst »Streber« zu nennen. Der Streber freilich schaut mich bloß an (so schauen Menschen, die sich eine dumme Bemerkung über sich selbst schon tausendmal haben anhören müssen) und sagt: »Ich bin kein Streber, ich heiße bloß so.« Ich kann nicht sagen, dass mir das nicht peinlich wäre. Es ist mir peinlich, und wie immer, wenn man eine Peinlichkeit dadurch überspielen möchte, dass man eine noch größere draufsetzt, will ich ihn jetzt unbedingt, sofort, nach den Tabletten fragen.
»Ich nehme Tabletten«, sagt Streber. Das sagt er, ich hätte es voraussagen können, bevor ich ihn fragen konnte. Ich beginne, mich zu verkrampfen. Wie soll man mit einem tablettensüchtigen Menschen ein therapeutisches Gespräch führen, wenn er die Antworten auf die Fragen, die man ihm stellen möchte, stets vor den Fragen parat hat? Ich merke, wie ich mich in mich hineinverkrampfe. Ich stehe unter dem Druck, Streber eine derart hochintelligente, von ihm nicht erwartbare Frage zu stellen, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt, als mir zu antworten, nachdem ich die Frage gestellt habe. Also frage ich:
»Sie nehmen Tabletten, weil Sie glauben, kein Ich zu haben?«
Das ist die dümmste Frage, die einem einfallen kann, wenn man mit einem Philosophen spricht. Und Streber ist ein Philosoph, so viel steht fest! Mehr als achtzig Prozent der heute lebenden Philosophen glauben, kein Ich zu haben. Sie glauben, ihr Ich sei eine von ihrem Gehirn in grauer Vorzeit produzierte Illusion im Dienst des Überlebenskampfes. Die Theorie dazu lautet, dass Biomaschinen, die glauben, ein Ich zu haben, jenen gegenüber, die tatsächlich keines haben, weil sie nicht einmal fälschlich glauben, eines zu haben, sich langfristig an ihre Umwelt besser anzupassen imstande sind.
»Ja«, sagt Streber, »ich nehme Tabletten, weil ich glaube, kein Ich zu haben. Ich glaube aber nicht bloß, keines zu haben, ich habe keines.«
Vielleicht, denke ich, ist Streber doch kein Philosoph. Er bildet sich ein, er könne ein Ich haben, das keine Illusion wäre. Ich merke, wie ich mich entkrampfe, und in dem Maße, in dem ich mich wieder entspannt zu fühlen beginne, frage ich Streber ein wenig von oben herab: »Warum nehmen Sie dann die Tabletten, was immer das für Tabletten sind?«
»Weil«, sagt Streber, »mein Psychiater sagt, es sei zwar wahr, dass das Ich eine vom Gehirn produzierte Illusion sei, aber alle, die diese Illusion nicht hätten, schleunigst Tabletten nehmen sollten.« Wenn Streber verrückt ist, dann braucht er Tabletten, keine Gleichnisse. Ich aber wollte ihm ein Gleichnis offerieren. Das Gleichnis von den beiden Knöpfen, von denen man zuerst immer den falschen drückt.
»Angenommen«, so wollte ich Streber belehren, »ich will wissen, ob ich ein Ich habe. Ich drücke also den einen Knopf, das heißt, ich konzentriere mich auf mein Ich. Das war der falsche Knopf, denn jetzt merke ich, dass meine Konzentration ins Leere geht. Es ist, als ob ich kein Ich hätte. Was also entspricht dem jeweils anderen Knopf?« So hätte ich gefragt, und nun, ohne gefragt zu sein, antwortet Streber:
»Dem jeweils anderen Knopf entspricht, nicht auf sein Ich zu achten und nicht darauf zu achten, dass man nicht auf sein Ich achtet. Einfach vor sich hin zu leben, dies und das zu tun, eingebettet in die Plazenta der eigenen Erlebnisse, die kommen und gehen. Das ist der andere Knopf, nicht wahr? Solange alles läuft, wie es läuft, ist das Ich da. So einfach, wie das Leben da ist. Da und ungreifbar.«
»Nun also entschließe ich mich«, fährt Streber fort, »diesen anderen Knopf zu drücken. Dazu muss ich mich tüchtig anstrengen, nicht darauf zu achten, dass ich nicht auf mein Ich achte. Und peng! Schon beginne ich, auf mein Ich zu achten in der Absicht, nicht auf mein Ich zu achten. Peng! Ich habe wieder den falschen Knopf gedrückt.«
»Es hilft nichts«, fährt Streber fort, »man muss zuerst den falschen Knopf drücken, um dann – vielleicht – den richtigen drücken zu können, den Knopf, der alles laufen lässt, wie es läuft. Um zu wissen, dass man ein Ich hat – was ganz und gar nicht dasselbe ist, wie einfach eines zu haben –, muss man zuerst auf den falschen Knopf drücken, nicht wahr? Man muss zuerst wissen, wie es ist, kein Ich zu haben, um dann eines haben zu können: bewusst zu haben, ohne dass das Bewusstsein, eines zu haben, es gleich wieder verschwinden lässt, weil man darauf achtet, wie es ist, eines zu haben. Habe ich recht?«
Читать дальше