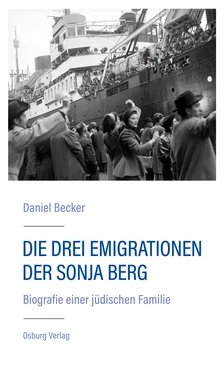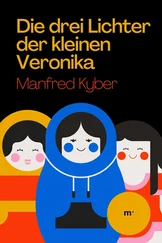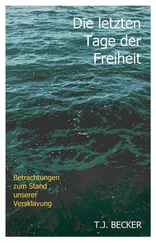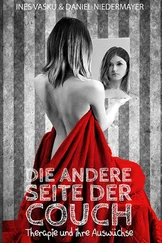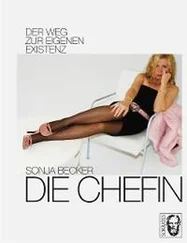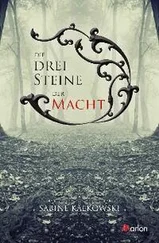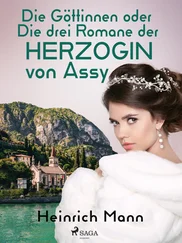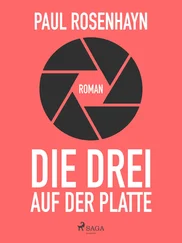2Früher finnisch, seit 1947 russisch, umbenannt in Selenogorsk.
3Jelgava, heute eine Kreisstadt in Lettland, muss in den beiden Kriegen so gründlich zerstört worden sein, dass kaum noch ein altes Haus vorhanden ist. Das Zentrum ist ein sowjetisches Plattenbau-Ensemble aus den 1960er-Jahren. Nur in den Randbezirken erinnern hier und da ein paar windschiefe Holzhäuser an die damalige Zeit.
4Russland erlebte durch Eisenbahn und Dampfschiffe seit den 1840er-Jahren einen Aufschwung des Außenhandels. Davon profitierten zunächst die Küstenstädte, in Kurland waren das Windau und Libau, sodass viele Menschen dorthin übersiedelten. Das war Juden jedoch verboten und wurde streng kontrolliert, sodass in dieser Zeit viele Juden in südliche Regionen ausweichen mussten um Arbeit zu finden. Die Arbeitsmigration von Jacob Moses Gittelsohn nach Tiflis scheint unter kurischen Juden kein Einzelfall gewesen zu sein.
5Das Mitauer Adressbuch von 1892 ist vollständig auf Deutsch verfasst, alle Straßennamen sind deutschsprachig, über 90 Prozent der verzeichneten Einwohner haben deutsche oder eingedeutschte jüdische Namen; auch alle öffentlichen Institutionen scheinen ausschließlich deutsche Namen gehabt zu haben. In Kurland, obwohl seit 1797 russische Provinz, war damals noch Deutsch die Behördensprache und die Sprache der gebildeten Oberschicht. Allerdings erschienen neben der deutschen ›Mitauschen Zeitung‹ auch eine russisch- und zwei lettischsprachige Zeitungen, offenbar waren also mehrere Sprachen im Alltag gebräuchlich.
6Laut Überlieferung starb Gustavs Vater, als dieser noch ein Kind war, weshalb Gustav früh zum Unterhalt der Familie beitragen musste.
7Im Heiratsregister der jüdischen Gemeinde in Mitau gibt es einen Eintrag vom 9. 1. 1883, der wahrscheinlich auf Gustavs Schwester verweist: Eheschließung von Levin Gittelsohn (31, geb. in Mitau, Sohn von Nekhmeje Gittelsohn) mit Julie Hackel (22, geb. in Mitau). Sie wäre somit ein Jahr älter als Gustav gewesen. Möglicherweise bestand mit der Familie des Bräutigams eine entfernte Verwandtschaft.
8In Mitau ist für das 19. Jahrhundert kein Rabbiner mit Namen Gittelsohn nachweisbar. Eine Besonderheit von Kurland war, dass es dort keine Talmudschule (Jeshiva) gab. Deshalb besuchten angehende Rabbiner aus Kurland zur Ausbildung Jeshivot im nahe gelegenen Litauen oder der Ukraine. In US-amerikanischen Rabbinerverzeichnissen taucht der Name Gittelsohn nur einmal auf: Benjamin Gittelsohn, geboren 1853 in Russland und Sohn von Jehuda Gittelsohn. Er studierte an der Talmudschule in Kaunas, Litauen, und wanderte später nach Cleveland, Ohio aus. Nach Alter und o.g. Umständen könnte Jehuda möglicherweise der von Sonja erwähnte ältere Bruder von Gustavs Großvater Moses Gittelsohn aus Mitau sein.
9Arthur Hackel, geb. 1864, Sterbedatum und -ort unbekannt, und Ludwig Hackel (Vater von Eva und Nora Hackel) geb. 1867, gestorben 1936 in Berlin, studierten beide je ein Jahr in Dorpat (ihre Berufsbezeichnung lautete ›Provisor‹) und führten seit 1895 gemeinsam in St. Petersburg die Puschkin-Apotheke. Sie befand sich in der Puschkinskaja 9, das Haus steht heute noch. Ludwigs Wohnung lag ein paar Häuser weiter in der Nr. 19. Er war unter anderem geschäftlich erfolgreich durch Herstellung und Vertrieb eines selbst entwickelten Mittels gegen Hämorrhoiden.
10Jeannot Hackel, geb. 1862 in Mitau, Sterbedatum und -ort unbekannt.
11Frz.: ›Gibt es da schon etwas mitzuteilen?‹
12Wahrscheinlich meinte sie damit Gaststudenten, die sie gelegentlich als Hauslehrer aufnahm.
13Russisch: ›Jetzt wird’s bunt‹, sinngemäß: ›Man sagt, dass es einen Aufstand geben wird.‹
14Teil von St. Petersburg nordwestlich der Newa.
15Nach der Niederschlagung der Unruhen versuchte das Zarenregime, die versprochenen Reformen wieder rückgängig zu machen.
16Siehe Kapitel ›Fredy – Unter dem Radar‹.
17In Finnland und Estland ist das Schaukeln eine Art Volkssport.
18Russisch: ›Das Wort‹ – gemeint ist mit Sicherheit ›Russkoje Slovo‹, die damals größte russischsprachige Tageszeitung, die seit 1895 in Moskau erschien und 1917 von den Bolschewiki verboten wurde.
19Der ›St. Petersburger Herold‹ war eine von zwei deutschsprachigen Tageszeitungen und erschien von 1871 bis 1914, dann wurde er verboten, weil mit Kriegsbeginn aller deutsche Einfluss aus Russland verbannt werden sollte. Der Herold war die Konkurrenz der älteren ›Petersburger Zeitung‹, vertrat politisch einen liberalen Standpunkt und legte zu dieser Zeit vor allem Wert auf eine kritische Berichterstattung gegenüber der konservativen Zarenmacht. Er brachte täglich unter dem Motto Unsere Presse eine exklusive Presseschau über die Top-Nachrichten der damals größten russischen Tageszeitungen. Weitere Inhalte waren Stadtnachrichten, Wichtiges aus dem Deutschen Reich, Wirtschaftsnachrichten, Romane sowie monatliche Beilagen zu Mode und Landwirtschaft.
20Gemeint ist die Marmorskulptur von Voltaire von Jean-Antoine Houdon, noch heute eines der vielen Glanzstücke der Eremitage.
21Danae von Tizian, 1930 von der Eremitage verkauft, seither National Gallery of Art, Washington DC.
22Gemeint ist offenbar der polnische Ringkämpfer Stanislaus Zbyszko, der um 1905 in ganz Europa und später in den USA sehr erfolgreich wurde. 1906 gastierte er für eine Saison in St. Petersburg. Eine amerikanische Website listet alle Matches auf. Sie verzeichnet: Sieg über Alexander Saikin, am 2. August, am 7. und 14. August, und nochmals am 1. September. An einem dieser Tage muss Gustav dem Kampf zugeschaut haben.
Revolution
Nach acht, Bonn 1987
»Unser geruhsames Leben in Petersburg endete schlagartig mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Meine Brüder, die inzwischen alle die Schule beendet hatten, die älteren beiden studierten bereits, mussten in den Krieg. Zum Glück nicht gleich, aber 1916 wurden alle drei eingezogen. Als Angehörige der ›Intelligenzija‹ wurden sie Nachwuchsoffiziere. Das machte die Sache für sie insofern besser, als sie nicht als Kanonenfutter verheizt wurden wie die Leute aus dem einfachen Volk, aber die Befürchtungen meiner Mutter, ihre Jungen ›zu irgendjemandes höherer Ehre‹ opfern zu müssen, rückten in den Bereich des Möglichen.
Russland war auf den Krieg miserabel vorbereitet, sowohl militärisch als auch im zivilen Leben. In den Geschäften gab es kaum noch etwas zu kaufen, für Lebensmittel zahlte man horrende Preise. Auf den Feldern und in den Fabriken fehlten die Arbeiter. Die meisten arbeitsfähigen Männer waren an der Front, wo sie wegen der schlechten Ausrüstung wie die Fliegen starben. Die Familien der Gefallenen stürzten oft in bodenloses Elend.
St. Petersburg wurde in Petrograd umbenannt – die Stimmung richtete sich zunehmend gegen alles Deutsche, und man tat besser daran, nicht in der Öffentlichkeit deutsch zu sprechen. Viele in Russland lebende Deutsche wurden ausgewiesen oder sagten sich, dass es besser sei, zu gehen. Wir waren davon nicht unmittelbar betroffen. Mein Vater hatte die russische Staatsbürgerschaft, meine Mutter war Deutsche, aber ihre Ehe mit einem Russen schützte sie vor der Ausweisung. Wir Kinder waren in Petersburg geboren und daher auch Russen. Aber selbst deutsch klingende Namen waren verdächtig. Zur Sicherheit setzte mein Vater seinem Vornamen damals ein e hinzu, Gustave, damit man es für Französisch halten konnte.
Schon lange war es bergab gegangen mit der Macht der Zaren. Nikolai II., der letzte Zar, interessierte sich kaum für die Regierungsgeschäfte. Er zog sich lieber in seine Sommerresidenz nach Zarskoje Selo zurück. Gelegentlich hatte er ein paar fähige Minister, die er aber beim nächsten Aufstand wieder davonjagte.
An seinem Hof gab es viele Günstlinge und andere finstere Gestalten, die auf die Politik Einfluss nahmen. Unter diesen war ein ganz Besonderer, das war Rasputin, ein sibirischer Wanderprediger und Wahrsager.
Читать дальше