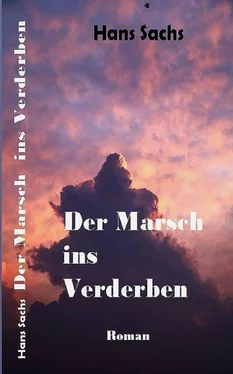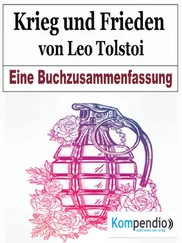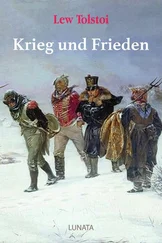In der heutigen Zeit nicht mehr vorstellbar ist, was im späten Mittelalter nach dem 30-jährigen Krieg im Erzgebirgischen verdient wurde. Und unter welchen Lebenssituationen der von seiner Herrschaft abhängige Fronarbeiter lebte. In der feudalen Rangordnung gab es die > Herrschaft <, die > Untertanen < und das > Gesinde <. [Fußnote 1]
1)Die Herrschaft konnte die Abgaben frei festlegen, welche von ihren Untertanen zu erbringen sind. Monetär waren das die Steuern. Jeder Leibeigene hatte 12 Groschen und ein Handwerker 6 Groschen zu entrichten. Das war viel Geld, als der preußische Gulden zu 8 guten Groschen bewertet war.
In der heutigen Zeit unvorstellbar, welche Fronarbeit zu leisten war und wie das Gesinde vegetierte:
Da verdiente in Großknecht im Jahr 8 Gulden, eine Großmagd und ein Mittelknecht 6 Gulden, eine Mittelmagd 4 und ein Ochsenknecht und die Hirtenmagd je 3 Gulden. Dafür bekamen sie freie Kost und Logis im Stall, auf dem Heuboden oder der Futterküche. Die Verköstigung bestand vorwiegend aus Hafergrütze, Graupen und Erbsen, Sauer- und Grünkohl, Rüben und Brot. Sonntags gab es Hirse- und Weizenbrei und etwas Fleisch, eine Kanne Bier nur zu Festtagen und zu Weihnachten eine Semmel.
Wenn diese Dienste um 1900 auch nicht mehr aktuell waren, so darf man doch davon ausgehen, dass um die Zeit weiterhin große Armut herrschte.
Die Renten- und Invalidenversicherung wurde 1890 eingeführt, zahlte allerdings erst ab dem 70. Lebensjahr. Das erreichten die meisten der Versicherten nicht, denn die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei nur 65 Jahren. Aus der Zeit stammt auch die Redensart, dass es zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel war, was man in der Tasche hatte.
Rudolf hat, wie die meisten Kinder dieser Zeit, früh zum Überleben seiner Familie beizutragen. Besonders Weberfamilien standen am unteren Ende der Entlohnung. Textilverarbeitung wurde vorwiegend in Heimarbeit ausgeübt, fast ausnahmslos in der Wohnküche, weil das der einzig beheizbare Raum in den kleinen Katen war. Die Spitzenklöppelei ist eine elegantere Form des Gewerbes und brachte etwas mehr Gewinn. Die allgemeine Schulbildung erlaubte eben mal das Erlernen der Grundkenntnisse vom Lesen und Schreiben. Oft fielen die Schulstunden aus, weil Erntearbeiten für die Ernährung der Familie Vorrang hatte. Im Winter machte der meterhohe Schnee den Schulweg unmöglich oder die Schulstube war nicht beheizbar. Auch ein Lehrer musste sich oft dazuverdienen, wenn er auch ein etwas angesehener Zeitgenosse war.
Fast ausschließlich sind die Leute vom niedrigen Stand mit ihren Kindern Selbstversorger. Wenige Ziegen meckerten oder Schafe blökten im Stall, und, wenns hochkam, auch eine Kuh. Im Hausgarten wurden Kartoffeln, Bohnen und weitere sättigende Nahrungsmittel angepflanzt. Das unwirtliche Klima im Erzgebirge und die kurzen Sommer verhinderten jedoch eine ertragreiche Ernte.
Die Kindheit von Rudolf war also alles andere als fröhlich. Meist kämpfte die Familie ums nackte Überleben. Schafe mussten geschoren, Wolle gesponnen, gewebte Stoffe gewaschen sowie die fertiggestellten Ballen in Tragekiepen zu den Färbereien und Aufkäufern in Olbernhau getragen werden. Das waren immer lange, beschwerliche Wege durchs Feld und finsteren Tann, denn gepflasterte Straßen gab es keine.
Doch trotz aller Mühsal – wenn im Winter sich der Schnee vor den Butzenscheiben türmte, der mit Holz geheizte, mitten im Raum stehende Bollerofen wohltuende Wärme verbreitete, wurden Heimarbeiten gerne erledigt. Andere Beschäftigungsmöglichkeiten gab es ja keine. Dazu sang man erzgebirgische Lieder, deren Texte von der trotz allem geliebten Heimat handeln.
Rudolf ist einer von den gescheiteren Söhnen im Dorf, denn als ihm als zehnjähriger die Armut bewusst wurde, mochte er sich für sein weiteres Leben nicht damit abzufinden. Als kleiner Junge erlebte er den Ersten Weltkrieg, in den Hungerwintern 16/17 war er gerade eben 12 Jahre alt. Sein Vater war eingezogen worden und zog mit 'Hurra' gegen die Franzosen in`s Gefecht. Rudolf als Ältestes der Kinder sorgte für das kümmerliche Durchkommen der Familie.
Auf ihm ruhte im kindlichen Lebensalter schon erhebliche Verantwortung, denn gemeinsam mit den Geschwistern hatte er zu lernen, mit den widrigen Umständen zu leben und das Überleben zu sichern. An eine Kindheit, wie sie die Generationen des 21. Jahrhunderts erleben, war nicht zu denken. Alles war Armut und Kampf. Kriegs- und Nachkriegsjahre des Ersten Weltkrieges prägten den Stammhalter. Die Revolution in Deutschland durchlitt er als junger Mensch, ständig hungrig und daher bestrebt, sich ein über seine Dorfschulbildung hinausgehendes Wissen anzueignen. Das war der Grund, weshalb er als Heranwachsender mit nationalsozialistischem Gedankengut in Kontakt kam.
Nur gelegentlich erreichte ein intelligenterer Familienvater einen Lebensstandard, der ihm mehr Achtung und damit ein etwas sorgloseres Leben verschaffte. Das war es, was Rudolf vorschwebte. Dafür wollte er eine bessere Schule in Marienberg besuchen. Aber bekommt er dazu eine Empfehlung?
Rübenau war im Mittelalter ein kleines Dorf in unmittelbarer Nähe zur tschechischen Grenze. Es wurde in der Zeit um 1580 gegründet. Flößer und Köhler sind die ersten Bewohner dieses Weilers. Bereits 1571, noch bevor das Örtchen entstand, hatten sie mit dem Bau von Flößteichen begonnen.
Der Gebirgskamm war mit undurchdringlichem Urwald bedeckt, dem Miriquidi. Wölfe und Bären verbreiteten Angst und Schrecken. Nicht nur, dass nicht selten Ziegen und die nicht mit Geld aufzuwiegenden wenigen Rinder gerissen wurden. Es ist geradeso vorgekommen, dass Babys angefallen und getötet worden sind. Die Flößerteiche ermöglichten die Nutzung des Waldreichtums, und daher entstanden in den nächsten Jahrzehnten verschiedene Eisenschmieden. In späteren Jahren nannte man den Ort scherzhaft das »Dorf der Schmiede« . In und um Rübenau wurde in geringem Maße Bergbau betrieben, der aber nicht allzu ertragreich war. Profitablere Erzlager fand man in der weiteren Umgebung, in Freiberg, Marienberg und Annaberg.
Im 17.und 18.- Jahrhundert erzielte die Bevölkerung durch die Silber- und Kohleschürfungen im Erzgebirge ein den damaligen Verhältnissen entsprechend angemessenes Einkommen. Da gab es im Gebirge erhebliche Zuwanderungen zu verzeichnen. Die Leute kamen aus den verschiedensten Glaubens- und Himmelsrichtungen. Neue Orte und kleinere Städte, meist in der Nähe der Erz- oder Kohlezechen, entstanden.
Die Zugewanderten waren oft Protestanten, die aus dem Böhmischen vertrieben wurden. Der Katholizismus unter Ferdinand II. um 1620 gewann massiv an Bedeutung. Durch Vertreibungen sind in Böhmen ganze Dörfer entvölkert worden und verfielen nach einigen Jahren. Unter sächsischer Flagge erträumte man sich ein neues Leben.
Durch seine Kinderzeit im Gebirge war Rudolf zu einem hilfsbereiten, doch kritischen Jugendlichen herangewachsen. Hilfsbereitschaft in der Jugendzeit macht ihn zu einem gern gesehenen Zeitgenossen. Die Erziehung in einer Großfamilie und die Konfrontation mit dem Leid in den Kriegs- und frühen Nachkriegsjahren lassen ihn dann zu einem Skeptiker werden. Auch in den Jahren nach der SS-Zeit, vom Kriegsende 1945 bis zu seinem Tod in den Achtzigern, kümmerte er sich mit Empathie um andere.
Seit der Machtergreifung durch die Hitlerpartei von 1933 bis zum Ende des Hitlerregimes zeigte Rudolf ein zweites, abscheuliches Gesicht. Er mutierte unter Nazigenossen zum Herrn über Leben und Tod.
Читать дальше