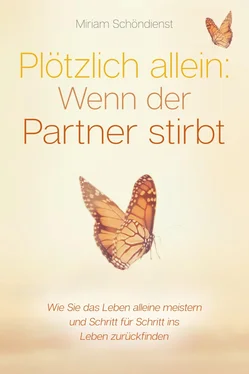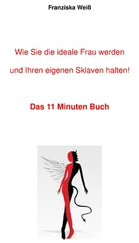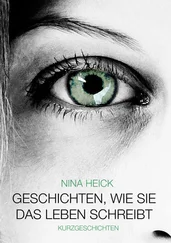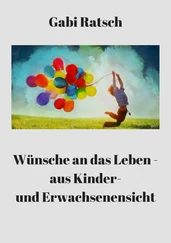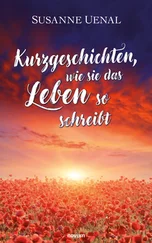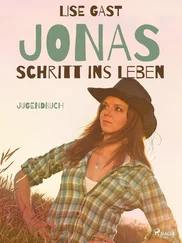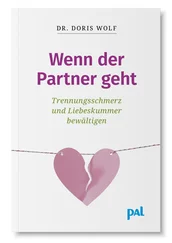Der einseitig gezogene Schlussstrich muss akzeptiert werden. Die meisten von uns können das nicht. Sie sind nicht bereit, den Tod anzuerkennen. Das macht es so schwierig, einen würdigen Abschied zu finden und loszulassen. Wir geraten in Panik, klammern, werden von Verlustangst beherrscht. Unser Repertoire an Mustern versagt. Wer nicht mehr mit dem Tod lebt, weiß keine Antwort.
Als das Altern und Sterben noch im Haus stattfand, wurden selbst Kinder Zeuge des Vergehens und Abschiednehmens. Das hat sie geprägt. Sie hatten ein Muster, nach dem sie sich selbst richten konnten. Seit das Sterben aus unserem Erlebnisraum verschwunden ist und zum klinischen Problemfall wurde, haben wir eine wachsende Herausforderung im Umgang mit Schmerz und Tod.
1.10 Von der Schwierigkeit des Gehenlassens
Das Akzeptieren des eigenen Schmerzes ist nicht einfach. Selbstmitleid hat einen Beigeschmack. Doch im Kontext von Achtsamkeit bekommt es eine ganz andere Wertung: Was passiert ist, ist schlimm und es tut weh. Wie eine körperliche Verletzung ist es mit Schmerzen verbunden. Wie nach jeder Operation oder jedem Sturz braucht es eine Zeit, um die Situation zu verstehen und zu akzeptieren. Dann können Sie sich schonen und erleben mit der Linderung des Schmerzes Heilung.
Menschen sind verschieden. Sie haben unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, vertreten unterschiedliche Ansichten. Auch Todesfälle unterscheiden sich. Wer ein Kind verliert, trauert anders als jemand, der nach langen Jahren des Zusammenlebens einen geliebten Partner gehen lassen muss. Um zu verstehen, brauchen Sie Zeit und können nicht auf ein Patentrezept zurückgreifen. Es gibt keins. Trauer ist individuell. Heute noch mehr als in der Vergangenheit.
Versuchen Sie, sich den Abschied wie einen langen Weg vorzustellen. Die Route ist Ihnen unbekannt. Sie wissen nicht, wohin der Weg Sie führen wird. Es wird Ihr Weg sein, deshalb gibt es keinen universellen Plan, der für alle und jeden gelten würde.
Mit diesem Buch können Sie sich auf die Reise machen und Ihr eigenes Trauerbuch anlegen, das Sie durch diese schwere Zeit begleitet. Nehmen Sie dazu ein besonders schönes Heft oder einfach einen Bogen Papier. Fertigen Sie ein Abbild Ihrer momentanen Situation. Dazu müssen Sie kein Künstler sein. Gestalten Sie einfach das weiße Blatt nach Ihren Vorstellungen. Kleben Sie eine Collage aus alten Kunstdrucken oder nehmen Sie alte Fotografien. Suchen Sie ein Gedicht oder eine Textpassage, die Ihren Empfindungen nahekommt.
Sie erleben in diesem Tun eine erste Annäherung und eine erste Auseinandersetzung mit Ihrem momentanen Zustand des Trauerns.
Kapitel 2: Abschiednehmen
Es ist versucht worden, Trauer wissenschaftlich zu erfassen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte Elisabeth Kübler-Ross, eine amerikanische Psychologin, ein Buch heraus, dessen Gedanken bis heute die Begleitung Trauernder bestimmen. In „On Death and Dying. What the dying have to teach doctors, nurses, clergy, and their own families“ entwickelte sie ein Fünf-Phasen-Modell. Eigentlich übersetzt: „Über den Tod und das Sterben. Was Sterbende Ärzte, Krankenschwestern, Geistlichen und ihren eigenen Familien beizubringen haben“ wurde es im Deutschen als „Interviews mit Sterbenden“ bekannt. Schon hier werden zwei wesentliche Dinge deutlich:
1 Die moderne Lebensweise brachte es mit sich, dass der Tod nicht mehr selbstverständlich war. Es kam zu Problemen, die dazu führten, dass nach wissenschaftlichen Mustern gesucht wurde.
1 Während Kübler-Ross in ihrem Original-Titel auf den lernenden Aspekt und den Prozess verweist, setzt der deutsche Titel auf subjektlose Distanz. Hilfreich ist es, in den Prozess einzutreten und sich dazu in Beziehung zu setzen. Wir müssen lernen, mit dem Sterben und dem Tod umzugehen. Wir müssen auch den plötzlichen Tod für uns erfassen und ein Verhältnis dazu finden.
2.1 Die fünf Trauerphasen
Elisabeth Kübler-Ross geht von 5 Phasen des Sterbens aus, die man auf die Trauer übertragen kann. Diese Phasen werden in individuell unterschiedlicher Zeit durchlaufen. Jeder braucht seinen eigenen zeitlichen Raum, bis er als trauernder Mensch den Verlust akzeptiert und zu einem Weiterleben findet. In diesem Prozess vollzieht sich der Abschied vom Gewesenen und der Beginn von etwas Neuem.
Kübler-Ross sieht diese Phasen als eine (unbewusste) Strategie, um den Schmerz zu bewältigen und das Unfassbare zu begreifen. Trifft einen ein Todesfall ohne Vorbereitung, wird der Ablösungsprozess wahrscheinlich besonders intensiv und schmerzhaft sein. Gibt es die Möglichkeit der Vorbereitung, die allein schon durch das gemeinsame Altern gegeben ist, erfolgt der Abschied in der Regel sanfter.
Die fünf Phasen nach Kübler-Ross sind:
1 Das Nicht-wahrhaben-Wollen, Leugnen und die Isolierung
2 Die Phase des Zorns und der Wut
3 Das Verhandeln
4 Depression, Schmerz und Leiden
5 Die Akzeptanz und Annahme der Situation
Diese Phasen vollziehen sich im Großen und Ganzen chronologisch (sie folgen aufeinander), doch kann es immer wieder zu Rückfällen kommen oder auch zum Überspringen einer Phase.
Wie lange ein Trauerprozess braucht, lässt sich nicht allgemein festschreiben. Es gibt auch keine Möglichkeit, Trauer zu beschleunigen. Sie muss individuell durchlebt werden. Das Modell der fünf Trauerphasen kann jedoch helfen, diesen Prozess und die eigenen Reaktionen rational besser zu verstehen.
2.2 Vom Leugnen und der Schutzfunktion der Seele
Erfährt man plötzlich vom Tod eines geliebten Menschen, kann man es nicht glauben, weil man es nicht glauben will. Die Reaktion des Leugnens ist ein Schutz. Warum sollte der nahestehende Angehörige plötzlich tot sein? Hat man nicht gerade noch miteinander gesprochen? War man nicht eben noch zusammen?
Der Gedanke, dass eine Verwechslung vorliegt, tröstet. Oft hoffen Angehörige, bis sie den Toten vor sich sehen, dass alles nicht stimmt, dass jemand anders den Unfall hatte, jemand anders getroffen wurde.
Manchmal kehrt das Leugnen auch nach der Gewissheit zurück. Man wacht am Morgen auf und hat das Gefühl, dass das alles nicht stimmen kann, dass es nicht wahr ist. Man fühlt sich wie in einem Albtraum und traut den eigenen Sinnen nicht mehr.
Das Leugnen kann jedoch auch bei einem zu erwartenden Tod einsetzen. Selbst wenn man durch Krankheit und Alter mit dem Schlimmsten rechnen muss und auf die Nachricht vorbereitet ist, kann es zu einer Phase des Leugnens kommen: Vielleicht haben sich die Ärzte geirrt? Vielleicht wacht er gleich wieder auf? Vielleicht hat sich die Schwester vertan und jemand anderes ist gestorben?
Die Psyche will sich schützen. Wir halten fest an unserer Hoffnung, weil wir die Realität nicht ertragen. Das Leugnen schützt vor emotionaler Überlastung. Man versucht sich zu entziehen, als wäre man nicht betroffen.
In dieser Phase rebellieren wir gegen das Schicksal, die Ärzte, die Angehörigen, den Verstorbenen, uns selbst. Eigentlich richtet sich unsere Wut gegen das Unabänderliche, gegen den Tod an sich und unsere Ohnmacht, nichts mehr tun zu können. Wir ertragen unsere Handlungsunfähigkeit nicht. Kübler-Ross spricht hier auch vom Neid auf diejenigen, die nicht betroffen sind, die niemanden verloren haben. Das „Warum ich?“ steht als Frage im Raum: „Warum ist der eigene Mann gestorben und nicht ein anderer Mensch?“
Dieses Aufbegehren, dieses Wütend-Sein auf alles und eigentlich nichts, ist eine Form der Abwehr und der Annäherung an die Realität. Es ist der Beginn einer Auseinandersetzung mit dem, was sich nicht mehr verändern lässt.
Diese Wut kann ungerecht sein. Diese Wut kann auch berechtigte Gründe haben. Das Fatale ist: Sie ändert nichts mehr. Man muss die Situation annehmen, wie sie ist. Der Tod ist nicht umkehrbar.
Читать дальше