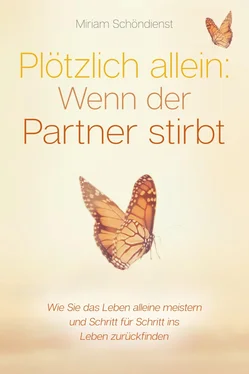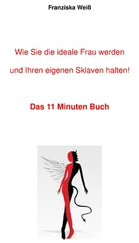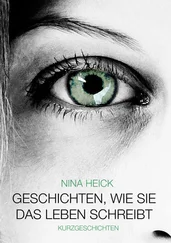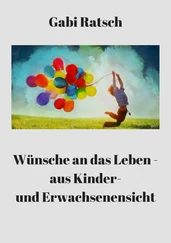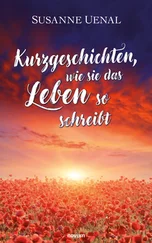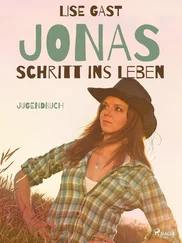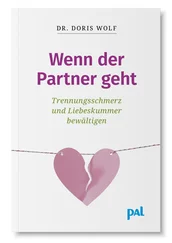Dieser Ratgeber kann kapitel- oder ausschnittsweise gelesen werden. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie beginnend mit den Emotionen nach dem Erlebnis des Sterbens und der Erkenntnis des Todes chronologisch geordnet (in zeitlicher Abfolge) Wege durch die Trauerzeit bis zur Ankunft in einem neuen Leben. Sie können das Buch wie eine Arbeitsanleitung lesen oder Sie wählen Schwerpunkten und informieren sich zu Themen wie Gestaltung der Trauerfeier, Umgang mit der Familie, Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Dabei helfen Ihnen die Kapitelüberschriften. Mit einigen Aufgaben und Übungen können Sie Ihr individuelles Trauerbuch zusammenstellen und so Ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden.
Kapitel 1: Vom Weggehen und Loslassen
Gab es früher eine allgemeine Conditio humana, eine Philosophie des menschlichen Seins, die Tod und Leben umfasste, sind wir heute in einer technokratischen Gesellschaft auf uns selbst geworfen. Der Tod findet nicht mehr statt. Zwischen Hightech und sich immer schneller drehender moderner Gesellschaft findet sich der Einzelne ständigen Anforderungen ausgesetzt. Tod und Sterben kommen nicht vor. Sie werden ins Klinische verwiesen. Während wir nach Selbstoptimierung und Konsum streben, ist uns das eigene Sein oft fremd geworden. Wir wissen nicht in Würde damit umzugehen. Bricht etwas aus dem funktionierenden System heraus, trifft uns das mit voller Wucht, ohne dass wir ihm wirklich etwas entgegenzusetzen hätten. Zu diesen fundamentalen Ereignissen gehört der Tod.
Der Tod eines geliebten Menschen versetzt uns in einen psychischen und physischen Ausnahmezustand. Die einen können nicht an sich halten, die anderen versinken in einen schockähnlichen Zustand, die dritten packt Panik. Wer äußerlich an sich hält und kühl vor sich selbst agiert, ist ebenso erschreckt wie derjenige, der sich in atemlose Geschäftigkeit stürzt. Alle stehen vor derselben Herausforderung: Sie müssen mit einem Schmerz umgehen und sie müssen akzeptieren, dass ein geliebter Mensch sie für immer verlassen hat.
Schon das Sterben kann zur Tortur werden. Wie begreift man, dass jemand einfach geht? Wie erklärt man sich, dass der andere niemals wiederkommen wird? Und vor allem: Kann man denn gar nichts tun?
Es fällt uns schwer, unsere Hilflosigkeit zu akzeptieren. Es fällt uns überhaupt zusehend schwer, mit dem Tod zu rechnen. Stirbt ein Mensch, suchen wir nach dem Schuldigen. Konnten die Ärzte wirklich gar nichts tun? Haben sie nicht einen Fehler gemacht? Oft bringen sich Menschen selbst um das Abschiednehmen, weil sie den Prozess des Sterbens nicht akzeptieren wollen. Sie zerstören die Momente, die dem Gehenden und den Bleibenden wichtig wären. Das geschieht nicht bewusst und absichtlich, sondern liegt in den gesellschaftlichen Veränderungen begründet, die dem Einzelnen suggerieren (einreden), er könne über alles bestimmen.
Doch über den Tod herrschen wir nicht. Da wir nicht auf ihn vorbereitet sind, begehren Körper und Psyche auf. Wir rebellieren gegen das Unabänderliche.
1.2 Was passiert mit mir?
Jeder kennt das wehmütige Gefühl, das einen befällt, wenn etwas verschwindet. Ein Kind verlässt einen, ein Kollege kündigt, ein Haus wird abgerissen. Immer spüren wir einen Schmerz. Diese Emotionen haben einen organischen Hintergrund. Die Amygdala (der Mandelkern) und der Hippocampus (eine Art Reptilienerbe in unserem limbischen System) werten unsere Emotionen. Auf jede Veränderung reagieren sie mit Angst und Stress. Sie geben dem Körper Signale und versetzen ihn in Alarmbereitschaft.
In Vorzeiten war es notwendig, Veränderungen sofort zu bemerken und schnell die Flucht zu ergreifen. Diese Signale wirken heute noch in uns nach. Wir nehmen wahr, dass sich etwas verändert und fühlen eine Art Schmerz und Aufregung.
Verlässt ein Kind das Elternhaus, um zu studieren, ist diese Aufregung präsent. Gleichzeitig wissen wir aber, dass es gut, wichtig und richtig ist, unseren Nachwuchs in die Welt ziehen zu lassen. Geht ein Kollege, wissen wir, dass er nicht aus der Welt ist; er geht seinen Weg und wir können ihn wiedertreffen.
Bei einem abgerissenen Haus können die Reaktionen schon unterschiedlicher sein: Der eine registriert es, den anderen, einen Architekturliebhaber, trifft es mitten ins Herz; es kann sogar zu Tränen kommen.
Doch was ist, wenn ein Mensch stirbt? Der Druck beim Verlust eines geliebten Angehörigen kann enorm sein. Er kann rigorosen Stress auslösen und bis zu Panikattacken führen. Trifft einen die Nachricht unvorbereitet, ist es am schlimmsten. Den akut einsetzenden Schmerz sollte man nicht unterschätzen. Liegt eine Phase langer Krankheit vor dem Abschied, kann man ihn wie eine Erlösung empfinden. Der Prozess des Trauerns hat bereits stattgefunden. Man hat die Situation akzeptiert. Tritt der Tod nun ein, kann man ihm vorbereitet entgegensehen.
1.3 Schockstarre und Pragmatismus
Der Tod eines nahestehenden Menschen kann einen völlig lähmen. Man erlebt sich als unfähig in einem fast stuporähnlichen Zustand (also in psychischer und motorischer Erstarrung). Meist hält diese Starre nicht lange an, sondern wandelt sich in eine Art Erschöpfung. Die Phase, in der jemand vom Tod eines Liebsten Kenntnis erhält, ist besonders sensibel. Gerade wenn der Tod plötzlich durch einen Unfall oder ähnliches kommt, muss zunächst überhaupt realisiert werden, dass jemand gestorben ist.
Nicht selten beginnt man zu telefonieren und leugnet die Tatsache schlichtweg. Der andere geht nur nicht an sein Handy, aber er lebt. Es muss eine Verwechslung vorliegen. Danach setzt der Schock ein und man kann erst einmal gar nichts tun.
Andere fahren einfach in ihren Tätigkeiten fort. Sie wollen und können nicht realisieren, was passiert ist. Sie agieren wie nach einem Autounfall, stehen auf und laufen weiter. Der Körper schützt sich mit dieser akuten Belastungsreaktion. Der Adrenalinanstieg sorgt dafür, dass Schmerzen unterdrückt werden. Diese neurobiologische Hochstresssituation kann zu einem Trauma führen, wenn nicht regulierend eingegriffen wird. Das ist jedoch oft schwierig, weil nicht kenntlich ist, was im Inneren des Trauernden passiert. Man selbst kann die Situation nicht wahrnehmen und adäquat (angemessen) reagieren. Der hormonelle Cocktail setzt einen außerstande, sich situationsspezifisch zu verhalten.
Doch auch Menschen, die sich vermeintlich „besser“ im Griff haben, können zu Übersprungshandlungen neigen. In dem Fall sind nicht nur irrelevante (unerhebliche) Ersatzhandlungen gemeint, sondern zum Beispiel der Wunsch, durch Arbeit, das Verrichten von alltäglichen Tätigkeiten oder einfaches „Weitermachen“, den Zustand vor dem Tod wiederherzustellen. Man flüchtet in die vermeintliche Normalität, in den Zustand, in dem noch alles in Ordnung war.
1.4 „Ich fühle gar nichts“
Viele gehen mit sich selbst hart ins Gericht. Sie erleben den Tod zunächst als reines Faktum und realisieren innerlich nicht, was passiert ist. Dieses Nicht-Fühlen wird als Herzlosigkeit gesehen oder als Unfähigkeit zur Empathie klassifiziert. Die Ursache kann auch hier in einer einfachen Schutzreaktion der Psyche liegen. Die im Körper agierenden Neurotransmitter (Botenstoffe) und Hormone befrieden die Situation. Ihre Zusammensetzung verändert sich so, dass der Körper aktionsfähig bleibt.
Diese Aktionsfähigkeit wird ebenfalls durch unsere evolutionäre Entwicklungsgeschichte begründet. Es war in Urzeiten notwendig, dass wir rechtzeitig und schnell flüchten konnten. Drohte Gefahr, reagierte der Körper mit einer Steigerung des Adrenalin-, Dopamin- und Serotoninspiegels. Damit konnten wir uns fokussieren. Das ist noch heute so.
Wenn Sie nichts fühlen, hat das nichts mit Gefühlskälte zu tun, sondern einfach mit einem Schutz, den Sie auch nicht willentlich beeinflussen können. In dem Moment, in dem diese organischen Vorgänge ablaufen, sind Sie außerstande, auf sich selbst einzuwirken. Sie können nicht weinen. Nicht, weil Sie der Tod nicht trifft und auch nicht, weil Sie den Verstorbenen nicht geliebt haben, sondern weil Ihr Körper Sie schützt.
Читать дальше