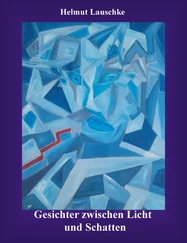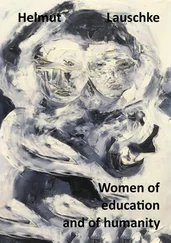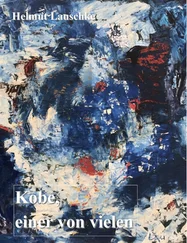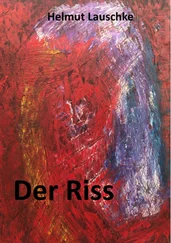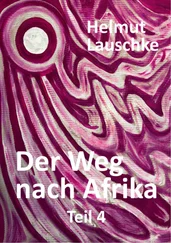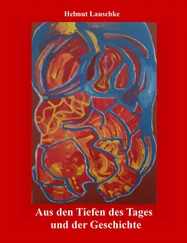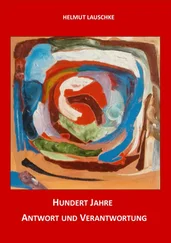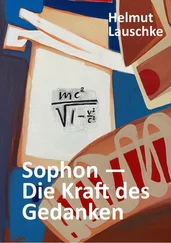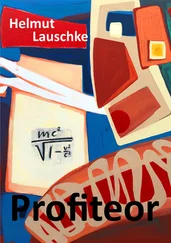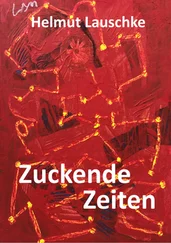Es herrschte eine betroffene Stille, als Eckhard Hieronymus Dorfbrunner die kleine Handbibel zuklappte, sich auf der Kanzel drehte und mit der Bibel in der rechten Hand die schmale Wendeltreppe herabstieg, wobei er den Talar vorne mit der linken Hand anhob, um die Absätze der Stufen zu sehen. Die Orgel intonierte mit einem kräftigen Bass das Lutherlied von der festen Burg, dessen Strophen die Gemeinde stehend mit einer wiedererlangten Inbrunst sang. Im abschließenden Gebet gedachte Eckhard Hieronymus der Toten des Krieges, auf beiden Seiten der Front, weil Jesus Christus nicht nur für die Toten auf deutscher Seite gestorben war. Er gedachte auch der Toten, die eines natürlichen Todes gestorben war. Alle ihre Seelen befahl er der Gnade und Liebe des einen Gottes an, von dem in der Predigt die Rede war. Dann gedachte er der Hinterbliebenen, der Waisen und der Witwen, der Ratlosen und der Verzweifelten, die den Schutz, den Trost und die Führung des Herrn in seiner maßlosen Güte dringend brauchten. „Möge uns der Herr trösten und aus dem Tal des Elends und der Verzweiflung herausführen; möge er in seiner großen Güte und Barmherzigkeit uns in dieser Not beistehen und uns in ihrer Bewältigung seinen Segen geben. Amen!“
Nach dem gemeinsam gesprochenen ‚Vaterunser‘ und dem Segensspruch über die Gemeinde, zu dem die verbliebene kleine Glocke, weil in zu hoher Tonlage, eher beiläufig belanglos als wichtig und kraftvoll läutete, brauste die Orgel auf. Der Organist, ein älterer Herr mit grauem Haarkranz, hatte wohl sämtliche Register gezogen, als unter dem dröhnenden Fortissimo der Posaunen, dass die Trommelfelle zu platzen drohten, die Fenster klapperten und die Wände zitterten, die Gemeinde einstimmte und die letzten beiden Strophen des Lutherliedes sang; womit der Gottesdienst sein Ende nahm. Eckhard Hieronymus Dorfbrunner trat die beiden Stufen vor dem Altar herab und ging zum Westportal, um die Menschen, die sich von den Bänken erhoben und dem Ausgang zugingen, beim Verlassen der Kirche durch ein freundliches Kopfnicken zu begrüßen, ihnen die Segenswünsche und das, was Paulus im 8. Kapitel des 1. Korintherbriefes von der Erkenntnis und der Liebe, die aufbaut, gesagt hatte, mit auf den Weg zu geben. Die Menschen mit ihren blassen Gesichtern, in denen bei den Älteren die Sorgenfalten hinzukamen, und bei den ganz Alten mit den Magergesichtern und den nach vorn gekrümmten Rücken, sie alle grüßten freundlich zurück. Einige gaben dem jungen Pfarrer die Hand, einige mit zitternder Hand, nachdem sie den Stock von der rechten in die linke Hand gewechselt hatten. Sie dankten für die Predigt, die ihren Eindruck nicht verfehlte, so die einen, die kraftvoll, so die anderen, oder nachdenkenswert war, so die noch anderen.
Der junge Pfarrer dankte für die freundlichen Worte, die er wohl verstand, dass sie nicht nur aus dem Kopf, sondern auch aus den Herzen kamen, wofür er besonders dankbar war. Eine Frau von schneeweißem Haar, die von ihrer Schwiegertochter am Arm geführt wurde, wischte sich bei der Begrüßung mit einem Taschentuch die Tränen aus den Augen. Sie sagte, dass ihr Sohn gefallen sei und ihre Schwiegertochter als Witwe mit vier kleinen Kindern zurücklasse, die jetzt keinen Vater mehr haben. Das ging dem Pfarrer sehr nah, der darauf so schnell nichts zu sagen wusste. Als er dann doch was sagen wollte, war die alte Frau mit ihrer Schwiegertochter bereits die Stufen vor dem Portal herabgestiegen. Ein Mann im mittleren Alter, der eine Kappe vor dem rechten Augen trug, drückte die Hand des Pfarrers und dankte ihm für die aufrichtigen Worte, als er darauf hinwies, dass das Wissen der Obrigkeit mit der Erkenntnis, wie sie Paulus auslegt, nicht übereinstimmte. „Herr Pfarrer, ich beglückwünsche Sie zu ihrem Mut, das so offen zu sagen; dabei haben Sie so recht. Vielen Dank! Machen Sie weiter so!“ Die Kirche hatte sich geleert. Herr Krause hatte die Sammelbeutel vor dem Ausgang bereits zur Sakristei mitgenommen, wohin nun auch Eckhard Hieronymus Dorfbrunner ging. Dort hatten sich der Konsistorialrat Braunfelder mit Frau und Tochter, der Oberstudiendirektor Dr. Hauff mit Frau, der Gutsherr von Falkenhausen und drei Herren vom Minenkonsortium eingefunden, um den neuen Pfarrer zu begrüßen.
Küster Krause strahlte dem eintretenden Eckhard Hieronymus mit den Worten „Das haben Sie gut gemacht!“, ins Gesicht und gab ihm einen väterlichen Klaps auf die linke Schulter. Der Konsistorialrat, der einen schwarzen Anzug mit weißem Stehkragen und schwarzer Weste trug, über der das metallene Kreuz mit dem Gekreuzigten hing, wie es die Superintendenten zu tragen pflegten, vermied eine erste Stellungnahme zur Predigt. Mit dem offiziellen Gesicht eines Geistlichen der höheren Stufe stellte er den Neuling den Herren vom Konsistorium vor, die ihm freundlich die Hand gaben, aber so, wie sie waren in ihren schwarzen Anzügen mit den schwarzen Schlipsen, kein Wort verlauten ließen, wie sie die Predigt aufgenommen hatten. Nur Frau Dr. Hauff, die sich, weil es gang und gäbe war, in der Anrede den akademischen Titel ihres Mannes gefallen ließ, meinte nach einer fast herzlichen Begrüßung, dass ihr die Predigt gut gefallen habe. Eckhard Hieronymus Dorfbrunner verstand die wohlmeinende Absicht, da sich die Herren einer persönlichen Meinung enthielten, was er als schade, vielleicht sogar als peinlich empfand. Ihr Mann, der den Titel durch eine, wahrscheinlich philologische Dissertation erworben hatte, hörte die Worte seiner Frau, drehte sich vom Konsistorialrat ab und dem jungen Pfarrer zu, wollte als Oberschulmeister offensichtlich seiner Frau nicht nachstehen, und sagte mit einem Gesicht, dem die verfehlte Leutseligkeit nicht abzuleugnen war, dass er für seine Jungfernpredigt einen Text gewählt habe, der ihm, das wurde ihm rasch klar, ins Herz geschrieben war.
„Das ist sehr freundlich von ihnen“, wollte Eckhard Hieronymus das faule Kompliment abwehren, was ihm nur teilweise und deshalb gelang, weil nun der Oberstudiendirektor in einen Monolog verfiel, der das Wissen eines Schulmeisters im Hochformat zum Ausdruck brachte, von dem der Apostel Paulus doch sagte, und der Herr Direktor müsste es gehört haben, dass das Wissen auf- und abblasbar ist, und das mit dem Menschen tut, der sich dieses Wissens bedient und sich damit hervortut. Jedenfalls ließ sich Herr Dr. Hauff nicht bremsen, der auch dann die Notbremse nicht zog, als er geschichtliche Bekanntheiten aus dem Leben des Apostels von sich gab. „Das wissen sie sicher“, setzte der Direktor schulmeisterlich an, „dass Paulus als Sohn jüdischer Eltern zum Stamme Benjamin gehörte und gleichzeitig römischer Bürger war, dass er an der Ermordung des heiligen Stephanus beteiligt war und erst auf seinem Wege nach Damaskus durch die Erscheinung des auferstandenen Christus zum christlichen Glauben bekehrt wurde.“ „Ja, das weiß ich“, bemerkte Eckhard Hieronymus. „Wissen sie auch, dass es Lukas war, der den Namenswechsel vom Saulus zum Paulus vermerkte, dass Paulus im Jahre 58 n.Chr. in Jerusalem festgenommen, bis 60 in Cäsarea gefangengehalten und dann vom Prokurator Festus nach Rom gebracht wurde?“ „Paulus wurde nach Rom gebracht“, fügte Eckhard Hieronymus hinzu, „weil sich Paulus als römischer Bürger für den Prozess, der ihm gemacht werden sollte, auf den Kaiser und das ‚Corpus Iuris Romanum‘ berief.“
„Was sagen sie da?, unterbrach der Konsistorialrat, der sich von den Herren vom Minenkonsortium abgewandt und sich neben den Herrn Oberstudiendirektor gestellt hatte. Eckhard Hieronymus wiederholte seinen Satz, den Konsistorialrat Braunfelder so nicht gelten lassen wollte. „Hat es denn einen Prozess gegeben?“, fragte er. „Aber Herr Rat“, fuhr nun der Oberstudiendirektor dazwischen, als hätte er einen Studienrat vor sich, den es zu belehren galt, „natürlich wurde ihm ein Prozess gemacht, dessen Verfahren allerdings wegen Mangels an Beweisen eingestellt wurde. Das war in den Jahren 61 bis 63. Das Martyrium der Enthauptung erlitt Paulus erst im Jahre 67 nach erneuter Gefangenschaft in Rom.“ Der Konsistorialrat bekam einen roten Kopf und strich über das metallene Brustkreuz, offenbar um sich nach der kleinen Bildungsblöße innerlich zu fangen. Die letzte Frage war, ob Paulus, der um das Jahr 10 n. Chr. In Tarsus geboren wurde, den irdischen Jesus gekannt habe. Da gingen die Meinungen auseinander; der Oberstudiendirektor zuckte mit den Achseln, und der Konsistorialrat tat sich schwer mit seinem ‘Ja’. Eckhard Hieronymus bemerkte zu Paulus, weil ihm das wichtiger war als die geschichtlichen Daten, dass er ein leidenschaftlicher Mensch mit einem Feuerkopf war, der sich dem Ideal des Glaubens ganz hingegeben hatte. Für ihn war Gott alles, dem er mit absoluter Ergebenheit diente. Arbeit, Mühsal, Leiden, Entbehrungen und Todesgefahren begleiteten ihn durchs ganze Leben. Er war ein unbeugsamer und unerschrockener Kämpfer seines Herrn Jesus Christus. Das Ereignis von Damaskus machte ihm die Einzigartigkeit der Erwählung als Apostel bewusst und verlieh Paulus ein gewaltiges Sendungsbewusstsein. Seine Erfolge in der Mission schreibt er allein der göttlichen Gnade zu.
Читать дальше