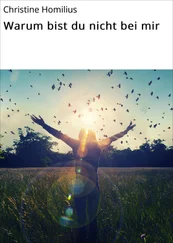Tatsächlich aber stellten sich die aussichtsreichsten Aufträge immer bei Klientinnen mit den teuersten Haustieren ein. Hündchen oder Kätzchen, manchmal waren es auch Frettchen – putzige Luxusgeschöpfe und die Lieblinge ihrer betuchten Frauchen – die der Nachwelt unbedingt erhalten bleiben sollten. Wenn schon nicht ausgestopft, so doch als Ölbild an der Wand. Sei es mit Besitzerin oder ohne.
Ein Knochenjob, der die Nerven gehörig strapazieren konnte; sind doch die Damen meist mit nörgelnden Gehabe angetan und mindestens ebenso exzentrisch wie ihre verwöhnten Tierchen. Aber: Sie zahlen wenigstens gut. Immer pünktlich dann, wenn der Unterhaltsscheck des Ex-Mannes eintrifft. Daher achtete ich bei Fertigstellung meiner Werke auf das Datum: kurz nach dem Monatsersten.
Möglicherweise ist es das zweite nervenaufreibende an diesem Broterwerb: Man ist demselben Existenzkampf ausgesetzt wie früher Jäger und Sammler es waren – ohne Beute kein Essen. In meinem sesshaften Fall: ohne Auftrag kein Essen und kein Atelier.
Im Moment aber machte ich mir Gedanken darüber, wie ich den Tag der Nicht-Arbeit verbringen könnte. Paul Lafargue sei Dank, ich räumte mir das „Recht auf Faulheit“ ein. Karl Marx möge mir verzeihen, aber ich schreite heute ohnehin vom „Reich der Notwendigkeit zum Reich der Freiheit“.
Unentschlossen, wie ein Schüler der gerade beschlossen hat, dem Nachmittagsunterricht fernzubleiben, aber nicht so recht weiß, was er mit dem geklauten Tag anfangen soll, betrachtete ich erst mal die Aussicht von der oberen Galerie aus. Von dort führte eine breite Prunkstiege zum Marmor-Vestibül des Museums hinab. Der Platz erinnerte mich immer an das Innere italienischer Kirchen – überdacht von einer gewaltigen Kuppel: ein Tempelbau für die Kunst, ein erhabener Anblick.
Hätte der Kaiser noch mehr Geld in die Kunst gesteckt, hätte er keines mehr für den Krieg gehabt. Ergo: keine Kriegserklärung an Serbien, kein verlorener Krieg und infolge auch kein Zweiter Weltkrieg … Und wenn mein Onkel Titten hätte, wäre er meine Tante , solch blöde Sprüche klopfte nur einer, nämlich Florian, kurz Flori genannt, das Ekel von Cousin. Denn, wann immer ich meinte – als ich noch mit ihm redete – Es wäre schön, wenn … oder: Was wäre gewesen, wenn … ich also meine Wunsch-ans-Christkind-Geschichten losließ, offenbarte er mir diese Plattheit. Zum Teufel auch mit Flori!
Unten im Foyer versammelten sich Touristen aus aller Welt, und die Atmosphäre hatte etwas von einem Bahnhof. Man wartete. Die einen meist auf die nächste Gruppenführung, die anderen – die es sich auf den bereitgestellten Lederbänken gemütlich gemacht hatten – darauf, dass ihnen nach den ausgedehnten Besichtigungstouren die Beine wieder gehorchen mögen. In der Zwischenzeit blätterten beide in Katalogen und Reiseführern, um sich auf den nächsten Programmpunkt, also auf die nächste Tortur, vorzubereiten.
Am Fuß der Treppe angekommen, lief mir wieder einmal Hubert über den Weg. Ein rühriger Museumsaufseher, der mit seinen annähernd sechzig Jahren locker in staatlich abgesicherter Frührente sein könnte, aber noch immer mit Leib und Seele seinen Job verrichtete, und das auch bis zu seinem letzten Atemzug tun würde, weil, davon war ich überzeugt, das Museum sein Leben ist.
„Weil zu Hause niemand wartet“, wie er meinte, „außer den beiden Wellensittichen Sethos und Ramses.“
Der eine war bereits der V. und der andere der VII., und die würden sich auch ohne ihn gut unterhalten.
In seiner kleinen Wohnung wäre ja so gut wie nichts los – im Gegensatz zum Museum. Und so gab er auch immer alles, was annähernd nach Sensation roch, gern weiter.
An diesem Tag berichtete er mir mit gewichtiger Miene, dass die Nacht davor, kurz vor Tagesanbruch, die Alarmanlage angeschlagen hätte. „Oskar“, sagte er, „der Sicherheitsmann hatte Dienst.“
Oskar war nicht sein richtiger Name. Aber alle nannten ihn so, weil er bei seinen nächtlichen Rundgängen nie das große Treppenhaus ausließ und an diesem Platz dann immer etwas aus seinem geliebten Schiller rezitierte.
„Weil es so schön hallt da.“
Also, der Alarm ging los – nicht wegen dem dröhnenden Organ des Oskar Werner-Verschnittes, sondern, wegen einem vermeintlichen Eindringling in den Archiven. – Genauer gesagt, in einem gewissen Archiv: im Mumiendepot!
Oskar, der eigentlich Willi hieß, musste seine Deklamation abbrechen und eilte in die Lagerräume. Die Polizei war bereits da, auch die Feuerwehr fuhr mit Signalhorn und Blaulicht in den Hof ein. Der Feuermelder hatte ebenfalls angeschlagen. Aber man fand nichts – keinen Eindringling und auch kein Feuer. Nur seltsam riechende, dünne Rauchfahnen schwebten noch umher, und vernebelten die Regale in denen die heimatfernen alten Ägypter ihren ewigen Schlaf schliefen.
„Es roch irgendwie nach Weihrauch und verbrannten Kräutern“, erzählte Willi seinem Freund Hubert … und der erzählte es mir.
„Wer soll denn hier einbrechen, da gibt es doch nichts zu holen, außer Trockenfleisch“, gab ich salopp meine Meinung zu dem Thema kund.
Sicher ein wenig pietätlos, doch Hubert schien mein laienhaftes Statement nicht abzuschrecken, denn er schaute mich verschwörerisch an und flüsterte: „Was glauben Sie, Isa, ist das vielleicht als ein schlechtes Omen zu werten?“ Dann sprach er noch leiser, doch nicht ohne sich zuvor nach allen Seiten umzublicken, als würde er sich vergewissern wollen, dass nicht zufällig einer aus der Direktion mithört. „Ich habe es immer schon gewusst, es ist Unrecht, die vielen Toten“ – damit meinte er die Mumien – „nicht in ihrer Muttererde gelassen zu haben, sondern sie hier im Keller zu verstauen.“
„In der Erde waren sie nicht – eher im Sand“, warf ich ein.
„Egal“, meinte er mit einer ablehnenden Handbewegung. „Ob Wüstensand oder unterirdische Felsräume. Sie gehören nicht hierher, man sollte sie den Ägyptern zurückgeben, damit man sie wieder in geweihter Erde begraben kann … und das so schnell als möglich!“
„Im geweihten Sand!“
„Ja, von mir aus im geweihten Sand!“
Hubert musste an diesem Tag arg zerstreut gewesen sein, sonst wäre ihm dieser schwere Denkfehler in seinem bevorzugten Wissensgebiet nicht unterlaufen. Und das fiel sogar mir auf, die ich wenig über die Kultur der Altägypter wusste, außer den Dingen eben, die man in der Schule am Rande so mitbekam. Dieses mysteriöse Volk war mir vorgekommen, als wäre es vom Mars angereist und auch dorthin wieder abgereist. Nur einzelne Eckdaten waren mir haften geblieben und einige Storys über ein paar herausragende Persönlichkeiten, etwa über den David Bowie der Antike: Echnaton.
Hubert aber hatte nicht nur ein Faible für das alte Ägypten, sondern auch für esoterisches Gedankengut. Wenn er seine Runden drehte, hatte er ja genügend Zeit, über derartig unnütze Dinge nachzudenken; und was ich befürchtete, kam dann auch sogleich.
„Was ist, wenn es die Flüche wirklich gibt?“ Er strich sich mehrmals über das Kinn, als wollte er da etwas Klebriges wegwischen, und beäugte mich so erwartungsvoll, als wäre ich Spezialistin auf diesem Gebiet. Aber vielleicht erhoffte er sich auch nur einen Rat – und das ausgerechnet von mir?
„Daran glaube ich nicht“, gab ich zur Antwort. „Außerdem liegen die Mumien schon so lange im Museum, da hätte ein Fluch längst wirken müssen. Ergo, Herr Hubert: Machen Sie sich keine Sorgen.“ Demonstrativ blickte ich auf die Zeitanzeige meines Handys, um damit anzudeuten, dass ich es eilig hätte. Ich verspürte absolut keine Lust, seinen Ausführungen weiter zu lauschen, vor allem, weil ich wusste, dass er gleich mit seinen Vorträgen über Parapsychologie beginnen würde. Über Pendeln, Tischchen rücken, und andere unerklärliche Phänomene, die ein unerschöpfliches Thema für ihn sind, aber immer einen höflichen Zuhörer mit viel Zeit voraussetzen. Die Geste mit der Uhr ließ ihn kalt. Vielleicht war sie zu dezent? Jedenfalls hielt er mich am Ärmel fest und schaute düsterer drein als gewohnt.
Читать дальше