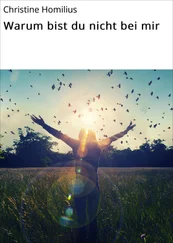Jetzt aber gab es wieder einmal große Aufregung um die schöne Charlotte: Sie stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Denn als sie „für kleine Mädchen“ ging – die Auszeit, die bei ihr auch immer einen neuen Anstrich im Gesicht beinhaltete –, nahm währenddessen ein unbekannt gebliebener Besucher ihren Pinsel und verbesserte – nein, nicht ihre Repro, sondern: die Vorlage, sprich: den Alten Meister … Eine Tragödie!
Wir Kopisten fürchteten, man würde uns in großem Bogen hinauswerfen und unsere Leinwände gleich hinterher. Nichts davon geschah. Der „Unfall“ wurde nonchalant vor der Öffentlichkeit geheim gehalten.
Das KHM ist ein Museum, in dem so etwas nicht passieren kann!
Abgesehen von diesem Vorfall tat sich in den darauffolgenden vier Monaten, in denen ich mich an mein Werk gemacht hatte, nichts Besonderes.
Bis zu jenem Tag.
Es war Mitte Juni, im Saal I war es drückend schwül. Warum? – Das wusste keiner so genau.
Ich befasste mich nun schon seit über einer halben Stunde intensiv mit dem von einem Perlenband gebändigten – wie könnte es anders sein – tizianroten Haar der schönen Venezianerin; versuchte genau diesen Farbton zu treffen, der natürlich eine Mischung aus mehreren Farbtönen war und nicht dem vorgefertigten Inhalt der Tube entsprach, auf der Tizianrot stand … Wäre ja auch zu einfach. Wie anders ließe sich sonst mein hohes Honorar rechtfertigen?
Ex würde es nicht auffallen, das war mir klar, aber mir. Bin ja schließlich keine der Tausenden Kopisten aus dem südchinesischen Dafen, die im Akkord Ölbilder Alter Meister herstellen ... Etwa eine Mona Lisa um achtzig Euro. Die weiteren zwei Nullen daran musste ich mir schon verdienen. Künstlerehre eben … oder: „Schön blöd!“, wie Charlotte fachkundig feststellte.
Nach einer gefühlten weiteren halben Stunde konnte ich mit meiner rekonstruierten Mischung auf der Farbpalette zufrieden sein und genehmigte mir eine Pause. Meine Ölfarben und den Terpentin packte ich, seit der unseligen Geschichte mit Charlottes Kunstkritiker – oder besser gesagt: des Alten Meisters Kunstkritiker – vorsorglich in mein Malkästchen und versperrte es. Dann schlenderte ich, wie ich es oft tat – eigentlich jeden Tag –, zum Korridor der großen Galerie, wo die Charakterköpfe in Stein gehauener, verdienstvoller Architekten, Kunstmäzene des Museums und ähnlicher, bereits verblichener Prominenz auf ihren Säulen angekittet den Weg säumen und einen mit unbeseeltem Blick anstarren.
Würde ich länger hier arbeiten, würde ich sie bestimmt auch mal im Vorbeigehen grüßen, so wie es ein Malerkollege immer tat, der an diesem Ort bereits das vierzigste Jahresjubiläum feierte. Der hatte die Bildergalerie schon fast durch und begann nun mit einem wirklich großen Werk: Wunder des Hl. Franz Xaver , 5 x 4 Meter – seine Meisterarbeit und sein letztes Bild, wie er meinte, bevor er in die Kiste hüpfe.
Soweit war ich noch nicht.
Hatte ich doch erst unlängst einen Auftrag erfolgreich abschütteln können, der mir mindestens weitere 18 Monate Dunkelhaft beschert hätte: Selbstmord der Kleopatra , 1,68 x 1,88 Meter, mehr als doppelt so groß wie das Mädchen. Nun gut, Königinnen benötigen eben größere Formate.
Und ich benötigte Licht! Also öffnete ich mein bevorzugtes Fenster, lümmelte mich auf den Ellbogen gestützt auf das marmorne Fensterbrett und kaute an einem entfernt nach Erdbeeren, dafür mehr nach strohigen Kamut schmeckenden Bio-Müsliriegel. Erdbeere war nicht jeden Tag an der Reihe, manchmal war es einer mit Bananenaroma und ein anderes Mal schmeckte er nach Zwetschke oder zumindest annähernd so. Natürliches Pflaumenaroma stand jedenfalls auf der Packung. Richtiges Obst ins Museum mitzunehmen war verboten – wegen mutmaßlichen Mückenschisses auf den wertvollen Bildnissen.
Währenddessen meine Zähne vom frugalen Frühstück wie von einem Sandstrahl gereinigt wurden, ließ ich mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Eine Wohltat nach dem Aufenthalt in einem von schummrigem Kunstlicht durchtränkten Raum.
So lehnte ich eine Weile da, hatte die Augen geschlossen, und wartete auf die kleinen dunklen Punkte und Fäden auf karneolrotem Grund, die man wahrnehmen sollte, wenn man sich bei hellem Licht seine Augenlider von innen ansieht. Und da eben dachte ich an nichts – an gar nichts! Es war einer jener gnadenvollen, seltenen Augenblicke des Nicht-Denkens, wie sie einem rastlosen Künstlergeist nur selten gewährt werden. Ich suhlte mich in dieser Schwebe zwischen unkreativer Geistesabwesenheit und … fast Einnicken.
Plötzlich durchschnitt etwas die Stille. Ich erschrak und riss die Augen auf, sodass ich in dem Moment – wohin ich auch blickte – nur dunkle Scheiben, wie lauter kleine verfinsterte Sonnen, sah. Vom Hof unterhalb kam etwas … da schallte etwas herauf, laut und lang gezogen. Ein Klang, so markerschütternd grell, als hätte ich das Endstück einer Blechgießkanne im Ohr stecken und ein Orkan würde vorbeisausen, oder etwas ähnlich Verwüstendes, das eigentlich nur ein Neurologe definieren könnte, falls er sich je mit Klängen von Blasinstrumenten und deren Auswirkung auf die menschlichen Nervenenden auseinandergesetzt hat. Heavy Metal!
Kurz darauf setzte ein Singsang ein, den man im ersten Moment für das Wehklagen eines barfüßigen Siegfried hätte halten können, der auf der Wiener Opernbühne gerade in die Dornen eines ihm zugeworfenen Rosenstrauches getreten war.
Dann war Stille … die aber nur wenig später von einem wahren Schwall an unverständlichen Wortlauten abgelöst wurde, so als würde sich der waidwunde Opernstar über sein unsensibles Publikum beklagen. Also konnte es sich nur um einen Gaststar handeln.
Ich beugte mich vorsichtig über das breite Fensterbrett und sah die zwei Stockwerke in den Hof hinunter; aber meine Augen waren geblendet vom Sonnenlicht, daher konnte ich nur eine Gestalt, wie einen dunklen Schatten, wahrnehmen. Der stand in der Mitte des weitläufigen Innenhofes, nein: kniete gleich neben der hohen antiken Säule und hielt beide Arme in die Höhe, als würde er die Sonne anflehen.
Diese Szene hatte etwas Beunruhigendes; sie passte so gar nicht in den geordneten Museumsalltag … Da konnte etwas nicht stimmen! Und als ein von Natur aus hilfsbereiter Mensch rief ich ohne zu zögern hinunter: „Haaallo, da unten …! Brauchen Sie Hilfe?!“
Mein Rufen brach sich an allen Ecken des Vierkanthofs und klang ähnlich schauerlich wie das vorangegangene Lamento meines vermeintlich Hilfsbedürftigen.
Jäh brach dieser mit seiner Aktion ab, sprang auf, hastete durch den Innenhof, als würde eine Meute Museumswärter hinter ihm her sein, und verschwand in einem der Tordurchgänge, die zu den Archiven führen.
Ich wartete noch eine Weile auf eine Zugabe, aber den waidwunden Sänger sah ich nicht mehr hervorkommen. Stattdessen ein scharfes Kreischen, es klang so, als wäre es ganz nah an meinem Fenster.
Und da erst fiel mir der Vogel auf.
Er saß auf der Spitze des alten Monolithen, er sah aus wie ein Falke. Aber er war um einiges größer als die mir bekannten, zumindest als die, wie man sie in Wien gewöhnlich antrifft – die der Stadtverwaltung helfen, auf humane oder besser gesagt natürliche Weise der Taubenplage Herr zu werden.
Der war ein Prachtexemplar. Sein graubraun-weißes Gefieder glänzte in der Sonne, als wäre es aus Fayence, und der Wind bauschte seine kurzen Brustfedern auf, die wie Schuppen eines Kettenhemdes unter seinem Raubvogelkopf angeordnet waren. Um meine Furcht vor großen Vögeln zu kaschieren, gab ich salopp von mir: „Hi, Piepmatz! Tauben gibt es hier keine – aber magst du vielleicht einen Kamutriegel?“
Der Vogel blickte direkt zu mir herüber, seine durchdringend schwarzen Augen fixierten mich für einige Sekunden; fast schien er mir – empört! Ich hatte noch nie einen empörten Vogel gesehen, doch dieser war es offensichtlich. Kurz darauf flog er mit kurzen, schrillen Lauten davon, hinaus aus dem Hof in das stumpfe Blau eines Großstadthimmels.
Читать дальше