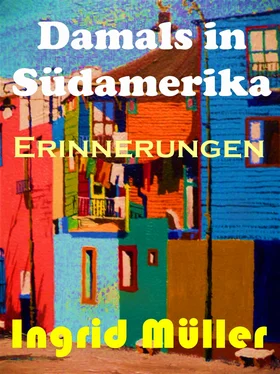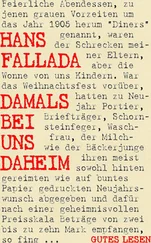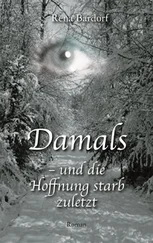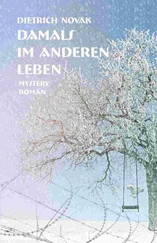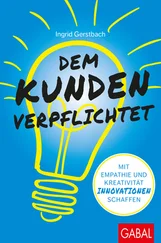Ingrid Müller - Damals in Südamerika.
Здесь есть возможность читать онлайн «Ingrid Müller - Damals in Südamerika.» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Damals in Südamerika.
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Damals in Südamerika.: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Damals in Südamerika.»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Damals in Südamerika. — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Damals in Südamerika.», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
„Da singe ich mit“, sagte ich zu meinem Mann.
„Frag den Schwarzen doch mal, wie ich den Chorleiter erreiche.“
Mein Mann, der fließend portugiesisch spricht, erzählte dem Zerberus daher, seine Frau sei eine große Sängerin und habe in der weltberühmten Messias-Aufführung in Deutschland mitgesungen und wolle jetzt den Hochschulchor tatkräftig unterstützen. Der Mann war beeindruckt. Er wisse das nicht, aber gleich käme eine Dame, die uns weiterhelfen könne. Es dauerte noch eine Weile, dann wurde das Gitter einen Spalt aufgemacht und wir herein gelassen. Eine kleine, zerbrechliche, überaus freundliche alte Dame, die deutsch sprach, schrieb uns Adresse und Telefonnummer auf, und als wir uns bedankten, sagte sie enttäuscht:
„Und in das Konzert heute wollen Sie nicht gehen?“
„Doch gerne, aber es gibt ja keine Karten mehr.“
„Kommen Sie mal mit.“
Der Saal war fast zur Hälfte leer. Es waren Ehrenplätze, die alle nicht besetzt waren, während draußen viele Leute gerne noch hereingekommen wären.
Wir wollten bezahlen.
„Nein, nein, lassen Sie nur.“
Ich sang also im „Messias“ mit, und wir waren von da an regelmäßige Konzertbesucher.
Eines Tages entdeckte ich die Ankündigung eines Quartetts aus dem Kölner Gürzenich-Orchester.
„Den kenne ich“, sagte ich und zeigte auf den Namen eines Musikers.
Ich hatte ihn nach einem Konzert im privaten Rahmen kurz vorher kennen gelernt. Da ich inzwischen wusste, wo der Künstlereingang des Konzerthauses war, ging ich in der Pause um das Gebäude herum und fragte nach den Künstlern. Die Armen hingen völlig erschöpft und schweißgebadet auf ihren Stühlen. Der Jetlag und die Hitze machten ihnen mächtig zu schaffen. Der Künstler kannte mich offensichtlich nicht wieder, und ich machte mir den Spaß, ihn im Namen der brasilianischen Regierung recht herzlich willkommen zu heißen. Er stand kraftlos auf und schüttelte mir die Hand, und die anderen Drei riefen:„Ja und wir?“
Sie lachten dann schadenfroh als sich herausstellte, dass ich doch nicht von der brasilianischen Regierung war.
Wie sehr Besuchern das Klima in Rio zusetzt, haben wir erlebt im Maracana-Stadion, als Beckenbauer und die Bayern-Elf gegen eine brasilianische Mannschaft zum Fußball antraten. Es war eine müde Vorstellung, und sie wurden regelrecht überrollt. Das war auch nicht anders zu erwarten, da die Spieler keine Zeit hatten sich zu akklimatisieren, sondern gleich einen Tag nach der Ankunft auf den Platz mussten.
Nun hat die Weltmeisterschaft in Brasilien stattgefunden. Wir alle haben – bequem auf der Couch liegend oder mit einem kühlen Bier beim PublicViewing - die Qual der Fußballspieler in dem mörderischen Klima miterleben können, und mancher hat sich dabei die Frage gestellt, ob der Sport wirklich zur Gesundheit und Gesunderhaltung beiträgt.
Brasilien, ein Land, dass so weit von uns entfernt ist, rückt jetzt näher an uns heran. Die Medien berichten häufiger, besonders über die sozialen Missstände, auf die sich das Augenmerk der Weltöffentlichkeit wegen der anhaltenden Proteste gegen die hohen Kosten für die WM richtet.
Damals habe ich einige Aufzeichnungen gemacht, und wenn ich sie mir heute durchlese, erscheinen sie mir nach wie vor aktuell. Damals schrieb ich:
COPACABANA
Der Strand von Copacabana ist der schönste der Welt. So haben ihn Dichter besungen, so sehen ihn die Brasilianer, und so erleben ihn unzählige Besucher.
An diesem wunderschönen großen breiten Sandstrand gibt es weder Toiletten – die würden den Blick von der Avenida auf das Meer stören – noch Papierkörbe, was übrigens eine Fehlinvestition wäre, denn ein guter Brasilianer benutzt so etwas höchstens, um darin Feuer anzuzünden. Wenn sich die Sonne am Nachmittag hinter den Hochhäusern verkriecht, die braunen Tangamädchen buntgekleidet nach Hause schlendern und nur noch die unermüdlichen Fußballspieler auf dem schweren Sandboden für die nächst Weltmeisterschaft trainieren, sieht der Strand von Copacabana nicht mehr so aus, dass ihn Dichter besingen würden. Hunderte von bunten Pappbechern, Bierdosen, Sonnenölflaschen – hin und wieder ein Paar ausgediente Schuhe – liegen herum und erzählen die Geschichte eines warmen Tages.
Spätestens am nächsten Morgen ziehen sie auf, die Männer vom Strandkehrdienst, die „ligeros“: schwarzes Gesicht, Kleidung grell-orange, manchmal eine ausgefranste Wollmütze verwegen bis zu den Augenbrauen herabgezogen. In breiter Front durchkämmen sie den Sand. Vorweg einige, die den Müll portionsweise zu Häufchen zusammenharken. Nicht sehr sorgfältig. Was soll’s auch. Danach paarweise mit großen Drahtkörben die Häufchenaufsammler, auch nicht sehr sorgfältig. Der Wind verteilt den Rest.
Zwanzig Männer zähle ich. Sie haben es nicht besonders eilig. Bei einem Häufchen angekommen, bückt sich immer nur einer von ihnen, um den Unrat aufzusammeln, während der andere ihn beaufsichtig. Es scheint hier eine strenge Hierarchie zu herrschen.
Das träge in der Sonne dahindösende deutsche Gehirn beginnt plötzlich zu denken: Was könnte die Stadt Rio an Kosten sparen, wenn überall Papierkörbe aufgestellt und auch benutzt würden? Aber dann wären ja diese 20 Männer arbeitslos. Es sind ungelernte Kräfte, größtenteils Analphabeten, die das vom Staat festgesetzt Mindestgehalt beziehen mit einer Kaufkraft, die etwa 200 DM
entspricht. Es reicht zu Feijoada, dem brasilianischen Nationalgericht aus Reis mit schwarzen Bohnen. Also, ein positiver Aspekt?Der Strand ist frisch gesäubert. Wohin mit meiner Bananenschale? In den Sand damit, denn in jedem von uns steckt ein Brasilianer. Und im übrigen: Mein Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
SPIELPLATZ
Der Stadtteil Copacabana gehört zu den bevorzugten Wohngegenden Rios. Die modernen Appartement-Häuser, die immer mehr die gemütlichen alten portugiesischen Villen verdrängen, werden von Porteiros in Uniform bewacht, die darauf achten, dass kein Unberufener das Gebäude betritt, dennRaubüberfälle gibt es täglich in Rio. Außerdem reinigen diese Porteiros das zum Haus gehörende Stück Bürgersteig, jedenfalls dann, wenn die Ergebnisse der brasilianischen Hundeliebe Passanten veranlassen, sich in Sprüngen fortzubewegen. Außer Hunde lieben die Brasilianer Kinder, ihre eigenen und ohne Unterschied auch die anderer Leute. Eine kinderfreundliche Stadtverwaltung hat dafür gesorgt, dass es überall in den vornehmeren Wohngegenden hübsche Spielplätze für die niedlichen Kleinen gibt.
Unser Spielplatz liegt besonders schön. Auch bei heißem Wetter weht angenehm eine frische Brise. Besserer Leute Kinder werden von schwarzen Dienstmädchen zum Spielen gebracht. Die ganz Kleinen sitzen auf dem Boden und krabbeln im Sand. Aber auch besserer Leute Hunde gehen hier „Gassi“. Sie laufen zwischen den Kindern herum, heben ein Bein oder zeigen, wie gut ihre Verdauung funktioniert. Oft muss man Slalom laufen, um diesen Produkten auszuweichen, und der Duft, den meine kleine Tochter verströmt, kommt nicht immer aus ihrem Höschen.
Brasilianer haben ein gebrochenes Verhältnis zum Umweltschutz. Kinder werden der Einfachheit halber dort abgehalten, wo sie gerade spielen, und so kommt die Pipi der Kleinen zu der der Hunde. Wenn ein paar Rangen auf die Bäume steigen, um es von oben herabregnen zu lassen, empfinden das alle als eine Mordsgaudi. Um die aus Zement gegossene Spieleisenbahn macht man am besten einen großen Boden. Der Eisverkäufer, der gerade aus der Lokomotive kriecht und sich die Hose zuknöpft, wird zwar vom Polizisten lässig ermahnt, zeigt aber nicht unbedingt die Miene eines Büßers. Zum Glück wird auch unser Spielplatz regelmäßig gefegt, und der häufige tropische Regen mache alles wieder gut.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Damals in Südamerika.»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Damals in Südamerika.» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Damals in Südamerika.» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.