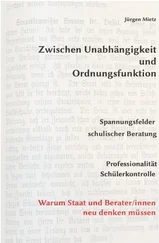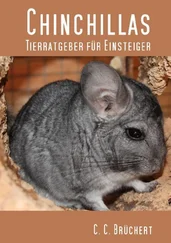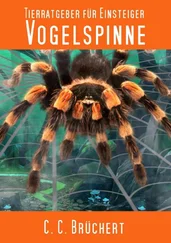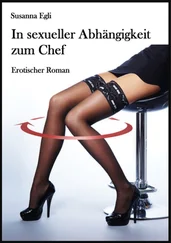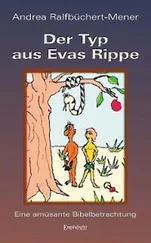Der Kontakt zu ihren Gefühlen geht Co-Abhängigen zunehmend verloren: Da sie sich ständig mit den Gefühlen und Erwartungen anderer beschäftigen, ist für die eigenen kein Platz mehr. Ein weiteres Wesensmerkmal für Co-Abhängigkeit stellt das Verzerren von Gefühlen dar: Betroffene „verdrehen“ unbewusst negative Emotionen in positive, um ihrem Selbstbild gerecht zu werden. Gelegentlich kommen unterdrückte Gefühle in einem unkontrollierten Wutausbruch zum Vorschein.
In dem Bestreben, es allen recht zu machen, belügen Co-Abhängige sich und andere. Angehörige eines Suchtkranken können nur mithilfe von Täuschungsmanövern eine Scheinrealität aufrechterhalten und den Süchtigen vor Konsequenzen bewahren.
Die größte Angst von Co-Abhängigen ist es, verlassen zu werden. Unvorhersehbare Veränderungen versetzen sie ebenso wie Konflikte und Auseinandersetzungen in Panik.
Weil Co-Abhängige ihrem eigenen Urteil nicht vertrauen, übernehmen sie kritiklos die Meinung anderer. Das fällt ihnen umso leichter, wenn ihr Gegenüber etwas ausspricht, das sie gerne glauben wollen: Selbst wenn es offensichtlich nicht der Wahrheit entspricht, halten sie standhaft am Gesagten fest.
Körperliche und seelische Selbstzerstörung
Im Verlauf der Co-Abhängigkeit verstricken sich Betroffene immer mehr in ein Netz aus Selbstbetrug und Selbstzerstörung. Körperliche und seelische Gesundheit werden vernachlässigt und nehmen langfristig Schaden.
Angst (vor Veränderung, vor Kontrollverlust, vor dem Alleinsein, vor Intimität …) spielt im Leben von Co-Abhängigen eine große Rolle. Aus dem Bestreben, den vertrauten Zustand beizubehalten, entsteht eine seelische und geistige Starrheit.
Fragen, die man sich stellen sollte
Bezugspersonen von Alkoholkranken geraten besonders häufig in eine Co-Abhängigkeit. Der folgende Fragebogen gibt Aufschluss, ob sich die Unterstützung des Suchtkranken im normalen Rahmen bewegt oder Anzeichen einer Co-Abhängigkeit aufweist - sinngemäß abgewandelt kann er auf alle Arten von Suchterkrankungen angewendet werden.
1. Haben Sie Ihren Angehörigen/Ihren Freund/Ihren Kollegen bereits mehrere Male erfolglos auf seinen übermäßigen Alkoholkonsum angesprochen?
2. Haben Sie schon mehrmals gemeinsam mit ihm Alkohol getrunken, um seinen Alkoholkonsum kontrollieren zu können?
3. Nehmen Sie Ihrem Angehörigen/Ihrem Kollegen Aufgaben und Verantwortung aus seinem Zuständigkeitsbereich ab?
4. Loben Verwandte/Freunde/Kollegen Sie für Ihren aufopfernden Einsatz?
5. Müssen Sie lügen und Unregelmäßigkeiten vertuschen, um Ihren Angehörigen/Kollegen zu schützen?
6. Fühlen Sie sich wertvoll und stark, wenn der Suchtkranke Ihre Hilfe braucht?
7. Zweifeln Sie in Bezug auf Ihren Angehörigen/Kollegen an Ihren eigenen Wahrnehmungen?
8. Hängt Ihre eigene Stimmung stark vom Befinden Ihres Angehörigen/Kollegen ab?
9. In Ihnen keimt die Hoffnung auf, dass sich alles zum Guten wendet. Sie setzen sich verstärkt für den Abhängigen ein, doch er erleidet einen Rückfall. Löst der Rückschlag bei Ihnen tiefe Verzweiflung und Niedergeschlagenheit aus?
10. Leiden Sie durch die ständige Belastung unter körperlichen und/oder psychischen Beschwerden?
11. Nutzen Sie selbst Alkohol und/oder Medikamente, um mit der Belastung fertig zu werden?
12. Haben Sie Ihrem Partner wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums bereits mit Trennung gedroht?
13. Haben Sie Ihrem Kollegen wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums bereits mit einer Gespräch beim Vorgesetzten oder einer Abmahnung gedroht?
14. Kommt es vor, dass Sie Ihrem Angehörigen/Ihrem Kollegen den Tod wünschen (durch einen Autounfall …)
15. Fühlen Sie sich von der Situation überfordert und würden am liebsten alles hinwerfen?
16. Glauben Sie, dass Ihr Angehöriger/Kollege ohne Ihre Hilfe vollkommen abrutschen würde?
17. Ziehen Sie sich vom gesellschaftlichen Leben zurück und geben Ihren Freundes- und Bekanntenkreis auf?
18. Kontrollieren Sie den Alkoholkonsum des Abhängigen, indem Sie beispielsweise seine Alkoholrationen einteilen?
19. Vergessen Sie Ihre Drohungen gegenüber dem Angehörigen/Kollegen oder reden nicht mehr darüber?
20. Fühlen Sie sich manchmal körperlich von Ihrem Angehörigen/Kollegen bedroht?
21. Denken Sie, dass Sie für den übermäßigen Alkoholkonsum Ihres Angehörigen/Kollegen verantwortlich sind oder zumindest eine Mitschuld tragen?
22. Resultieren aus dem Verhalten des Alkoholabhängigen finanzielle Probleme, die Sie stark belasten?
23. Fühlen Sie sich durch die zusätzliche Arbeit und die ständige Belastung überfordert?
24. Wenn Sie in einer Partnerschaft mit einem Alkoholkranken leben: Sind Ihnen wichtige Bereiche der Beziehung (körperlicher Kontakt, vertrauensvolle Gespräche …) abhanden gekommen?
25. Wenn Sie mit einem Alkoholkranken zusammenarbeiten: Sind für ein gutes Betriebsklima wichtige Aspekte (Ehrlichkeit, Verlässlichkeit …) verloren gegangen?
Das zeigen Ihre Antworten
Beantworten Sie in Ihrem eigenen Interesse die Fragen spontan und ehrlich. Notieren Sie, wie viele Fragen Sie mit „Ja“ beantwortet haben.
Wenn Sie mindestens drei Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, sind Sie möglicherweise bereits co-abhängig oder auf dem Weg dorthin.
Haben Sie mindestens fünf Fragen mit „Ja“ beantwortet, besteht bereits eine Co-Abhängigkeit. In diesem Fall sollten Sie fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen, auch wenn Sie sich des Problems im Moment noch nicht bewusst sind.
5.) Die Phasen der Co-Abhängigkeit
Wie eine Sucht nicht über Nacht entsteht, verläuft auch die Co-Abhängigkeit schleichend – die Betroffenen nehmen ihr Verhalten nicht als unnormal oder gar krankhaft wahr. Üblicherweise entwickelt sich eine Co-Abhängigkeit in drei Phasen:
Phase I: die Beschützer- oder Erklärungsphase
Die Bezugspersonen des Suchtkranken sind mit dem Suchtverhalten nicht einverstanden, finden für seine Ausfälle aber Entschuldigungen: Übermäßiger Alkoholgenuss wird mit beruflicher Überlastung, einem Todesfall in der Familie oder gesundheitlichen Problemen erklärt. Sie sind überzeugt, dass dieser Zustand nur vorübergehend anhält und sich durch genügend Hilfe und Zuspruch bessert. Daher entschuldigen oder vertuschen sie seine Ausfälle und erfinden gegenüber Nachbarn, Verwandten und Vorgesetzten Ausreden, um ihn vor unangenehmen Konsequenzen zu bewahren. Je unzuverlässiger der Abhängige mit zunehmendem Suchtmittelkonsum wird, desto mehr Verantwortung übernehmen Co-Abhängige in allen Lebensbereichen für ihn. Um die Sucht geheim zu halten, schotten sie sich ab und ziehen sich von ihrem sozialen Umfeld zurück: Insbesondere gesellschaftliche Anlässe werden gemieden, bei denen der Abhängige dem Suchtmittel übermäßig zusprechen könnte. Eigene Bedürfnisse treten zugunsten des Suchtkranken immer mehr in den Hintergrund, es hat oberste Priorität, ihn zu schützen und ihm beizustehen. Co-Abhängige versuchen mit allen Mitteln, den gewohnten Alltag aufrechtzuerhalten und nehmen damit den Süchtigen aus der Pflicht, sein Verhalten zu ändern.
Phase II: die Kontrollphase
Der Suchtmittelkonsum hält bereits über längere Zeit an, Suchtmittel oder -verhalten stellen den Mittelpunkt des Lebens dar. Der Co-Abhängige beginnt zu begreifen, dass es sich nicht um ein vorübergehendes Problem handelt. Er versucht, durch verschiedene Strategien den Suchtmittelkonsum unter Kontrolle zu bringen: Angehörige von Alkoholkranken verbannen jeglichen Alkohol aus dem Haus, markieren Flaschen und halten den Suchtkranken soweit möglich zu Hause fest, um seine Trinkmenge zu überwachen. Im Extremfall teilen sie ihm sogar die tägliche Alkoholration zu. Geht ihre Taktik auf und sein Alkoholkonsum sinkt, fühlen sie sich gut und ihr Selbstwertgefühl steigt – ein Wiederanstieg der Trinkmenge zerstört ihre Hoffnungen und macht ihr Selbstvertrauen zunichte. Die permanenten Kontrollen fordern den Süchtigen geradezu heraus, immer neue Wege zu finden, sein Suchtmittel zu konsumieren oder sein Suchtverhalten ausleben zu können: Die Kontrollphase ist geprägt von permanenter Anspannung, Misstrauen und gegenseitigen Vorwürfen. Heftige Gefühlsausbrüche können sich unkontrolliert entladen, worauf der Süchtige nicht selten mit körperlicher oder seelischer Gewalt reagiert. Häufig entwickelt sich eine Art „Hassliebe“: Der Co-Abhängige schwankt zwischen dem Wunsch, den Abhängigen um jeden Preis „retten“ zu wollen und fühlt sich für seine Rückfälle verantwortlich – gleichzeitig kämpft er mit einer immer größer werdenden Frustration und Überforderung.
Читать дальше