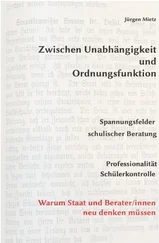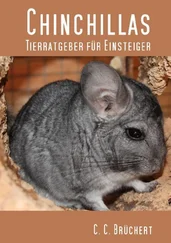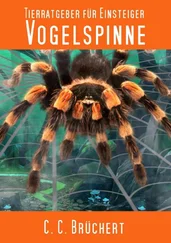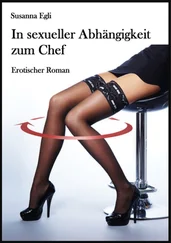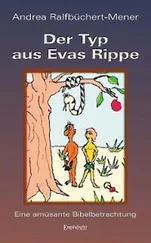Erstmals verwendet wurde der Begriff „Co-Abhängigkeit“ Mitte des letzten Jahrhunderts im Zusammenhang mit Alkoholismus. Zu jener Zeit setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Abhängigkeit von Alkohol nicht als Willensschwäche, sondern als Krankheit anzusehen ist; diese zieht zwangsläufig das Leben der ganzen Familie in Mitleidenschaft. Man erkannte, dass das soziale Umfeld durch Vertuschen hilft, das Leiden aufrecht zu erhalten und große Einbußen der Lebensqualität in Kauf nimmt. Langzeitbeobachtungen zeigten die höhere Rückfallrate von Alkoholkranken, deren Familien aufgrund fehlender psychologischer Unterstützung ihre Verhaltensweisen nach der erfolgreichen Entzugsbehandlung unverändert beibehielten: Angehörige hatten demnach zumindest eine Mitschuld am Fortdauern der Sucht.
Dieses Konzept veränderte sich mit der Zeit, Familienmitglieder wurden zunehmend als hilfsbedürftig wahrgenommen und zur Aufrechterhaltung ihrer psychischen und physischen Gesundheit in die Therapie einbezogen. Daneben entwickelte sich die These, dass es sich bei der Co-Abhängigkeit um ein eigenes Krankheitsbild mit Merkmalen einer Persönlichkeitsstörung handelt. In der Folge wurde der Begriff auf ein spezifisches Verhalten von Angehörigen Suchtkranker gleich welcher Art und als krankhaft wahrgenommene emotionale Abhängigkeit in der Partnerschaft ausgeweitet.
Eine einheitliche Definition der Bezeichnung existiert bis heute nicht. Vereinfacht gesagt, kann Co-Abhängigkeit im Zusammenhang mit Suchtkrankheiten als ein Verhalten verstanden werden, durch das Angehörige von Suchtkranken dessen Abhängigkeit auslösen, sie verstärken oder helfen, die Sucht aufrechtzuerhalten. Nicht alle Bezugspersonen von Abhängigen sind zwangsläufig co-abhängig oder weisen eine krankhafte Persönlichkeitsstruktur auf: Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Co-Abhängigkeit als eine eigenständige, durch Suchtmerkmale geprägte Erkrankung zu sehen ist. Im Vordergrund stehen überfürsorgliche Verhaltensweisen und der selbstlose Einsatz für den Erkrankten. Co-Abhängige leiden unter der Situation, vermeiden aber durch die Konzentration auf den Süchtigen, sich mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen auseinandersetzen zu müssen. Aus dieser unbedingten Hingabe des Co-Abhängigen können für ihn schwerwiegende körperliche und psychische Schäden erwachsen: Betroffene sollten sich nicht scheuen, bei Bewusstwerden der Problematik fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Co-Abhängige, die sich in der Beziehung zum Suchtkranken aufreiben, wuchsen überdurchschnittlich oft mit mindestens einem suchtkranken Elternteil auf. Bereits als Kind erfuhren sie nur Liebe und Zuwendung, wenn sie das Wohlbefinden dieses Menschen in den Mittelpunkt stellten und auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse verzichteten.
Generell stellen emotional gestörte Familienbeziehungen einen guten Nährboden für eine spätere Co-Abhängigkeit dar: In vielen scheinbar intakten Familien dürfen Gefühle nicht offen gezeigt oder ausgesprochen werden. Negative Emotionen sind tabu, das Mitteilen von Freude oder der Stolz über eine erbrachte Leistung löst Unverständnis aus. Sich und die eigenen Gefühle immer unter Kontrolle zu haben und nach außen den Schein der „heilen Welt“ zu wahren, hat oberste Priorität. Lernen Kinder nicht beizeiten, ihre Gefühle wahrzunehmen und ihnen Ausdruck zu verleihen, können sie sich diese Fähigkeiten im Erwachsenenalter nur unter großer Anstrengung aneignen. Das permanente Unterdrücken von Gefühlen löst nicht selten seelische Erkrankungen wie Depressionen oder Angsterkrankungen aus und macht anfällig für die Manipulation durch andere.
Perfektionismus im Elternhaus ist ein weiterer Risikofaktor für eine spätere Co-Abhängigkeit. Treiben die Eltern das Kind zu Höchstleistungen an und sind nur schwer zufriedenzustellen, definiert sich das Kind ausschließlich über seine Leistungsfähigkeit. Um von den Eltern akzeptiert zu werden, muss es perfekt sein: Gute Leistungen werden als selbstverständlich hingenommen, kleine Schwächen und Unzulänglichkeiten getadelt. Dadurch fühlt sich das Kind ständig herabgesetzt und entwickelt statt einem gesunden Selbstbild Minderwertigkeitskomplexe. Gerät es im Erwachsenenalter in eine Beziehung zu einem Suchtkranken, führt es dessen Sucht nicht selten auf sein eigenes Versagen zurück und versucht durch aufopfernde Hingabe, diese vermeintlichen Defizite gutzumachen.
4.) Wie erkennt man das Problem?
Es liegt in der Natur des Menschen, Kranke und Hilfsbedürftige nach besten Kräften zu unterstützen. In eine Co-Abhängigkeit ausartender Beistand hilft weder dem Suchtkranken noch seiner Bezugsperson: Das unbewusste Aufrechterhalten der Sucht beeinträchtigt das Leben der Angehörigen in vielfältiger Weise. Eine Co-Abhängigkeit ist durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet, die nicht alle gemeinsam auftreten müssen. Auffallend ist, dass viele dieser Anzeichen die Suchtkrankheit selbst charakterisieren – das unterstützt die These, Co-Abhängigkeit als eigenständige Krankheit mit Suchtcharakter zu werten.
Als Wesensmerkmale der Co-Abhängigkeit gelten:
Co-Abhängige definieren sich so stark über die Beziehung zu anderen, dass oft von einer „Beziehungssucht“ die Rede ist. Sie verfügen über ein geringes Selbstwertgefühl und können sich nicht vorstellen, als Einzelwesen von anderen wahrgenommen zu werden. Aus diesem Grund erhalten sie Partnerschaften aufrecht, in denen sie zur Selbstaufgabe gezwungen werden. Co-Abhängige können sich schlecht von anderen abgrenzen: Sie identifizieren sich vollkommen mit den Gefühlen und Stimmungen ihrer Mitmenschen und verlernen, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und auszudrücken. Der Co-Abhängige ist sich seines Selbst so wenig bewusst, dass er die Grenzen zwischen sich und dem anderen nicht mehr erkennen kann. Sein Denken kreist stets um die Frage „Was halten andere von mir?“. Charakteristisch für die Außenorientierung ist auch das mangelnde Vertrauen in die eigene Wahrnehmung: Ihre intuitive Einschätzung einer Situation nehmen Co-Abhängige erst als berechtigt an, wenn sie von anderen bestätigt wurde.
Helfen-Wollen ist ein herausragender Wesenszug von Co-Abhängigen. Von anderen gebraucht zu werden, stärkt ihr Selbstwertgefühl – um sich unentbehrlich zu machen, tun sie alles für ihre Mitmenschen und nehmen ihnen gerne unangenehme Dinge ab. Oft ist im Zusammenhang mit Co-Abhängigkeit von „Märtyrertum“ die Rede: Obwohl Betroffene unter der Situation leiden, tun sie durch ihre übertriebene und fehlgeleitete Hilfsbereitschaft alles, sie über lange Zeit aufrechtzuerhalten.
Durch extreme körperliche und seelische Belastungen leiden Co-Abhängige unter stressbedingten Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Störungen oder Herzproblemen. Viele geraten in die Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder Medikamenten oder entwickeln Essstörungen.
Obwohl das Verhalten von Co-Abhängigen auf den ersten Blick selbstlos wirkt, nehmen sie sich unbewusst äußerst wichtig: Sie beziehen alles, was um sie herum passiert, auf ihre Person und übernehmen dafür die Verantwortung. Eng mit der Selbstbezogenheit ist das Fehlen von Grenzen verbunden – indem sie die Verantwortung für das Leben anderer übernehmen, greifen sie in schädlicher Weise auf deren persönliche Lebensbereiche über.
Co-Abhängige sind stets bestrebt, alles in ihrem Umfeld unter Kontrolle zu behalten. Sie sind überzeugt, die Wahrnehmung anderer beeinflussen zu können – wenn nötig, wenden sie Täuschungsmanöver an. Die vergebliche Anstrengung, permanent das Unkontrollierbare zu kontrollieren, kann schwere Depressionen auslösen.
Читать дальше