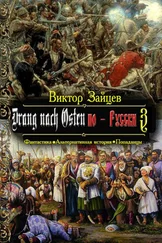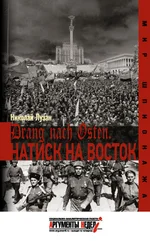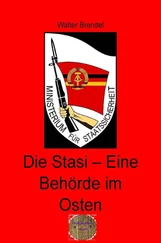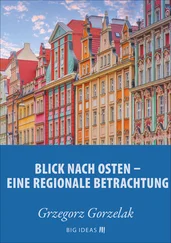Nämlich immer dann, wenn unsere Straße und alle umliegenden Straßen mit Westautos zugeparkt waren, schlenderten wir die Fußwege entlang, beguckten uns die Westwagen und lugten durch die Autoscheiben. „Eh hier, guckt mal!“ rief dann meist irgendeiner von uns, wenn er einen Wagen entdeckt hatte, der nicht nur 160 oder 180 km/ h auf dem Tacho stehen hatte, sondern sogar 200 oder 220. Dann wurde er in Augenschein genommen und entsprechend begutachtet. Auch Sportwagen waren darunter, ab und an ein Porsche oder Jaguar, der eben 240 km/ h oder mehr auf dem Tacho stehen hatte. Das war für uns unvorstellbar. Wie sollte man mit 240 Sachen über unsere Straßen fahren? Ein Ding der Unmöglichkeit! Beim Moskwitsch meines Vaters, der 34 PS hatte, ging der Tacho bis 140, beim Trabant nur bis 120 km/ h. Von Geschwindigkeiten jenseits der 200 konnten wir nur träumen, ja genau genommen konnten wir sie gar nicht beurteilen, weil das unserer Alltagserfahrung nicht entsprach. Wir orientierten uns lediglich an den abstrakten Werten. Aber es war nicht nur die Geschwindigkeit, was zählte. Für uns war ein Westwagen ein Auto von einem anderen Stern! Uns faszinierte schon die Art und Weise, wie der Wagen gefertigt war – sein ganzes Innenleben. Und damit meine ich nicht nur die Innenausstattung, sondern auch das, was drinnen an Klamotten und Utensilien herumlag: Sonnenbrillen, Etuis, Aktentaschen; all das waren kostbare Requisiten. Requisiten aus einer fremden Welt.
Ebenso fremd und ganz offensichtlich war die Tatsache, dass es zur Messe Nutten gab. Die machten es natürlich nur für Westgeld. Und das hab’ ich dann doch eher für Schallplatten ausgegeben – wenn ich welches hatte. Meist bekam ich es von meinen Großeltern, denn Rentner durften ja in den Westen fahren – sofern sie Verwandte hatten. Aber es gab noch etwas, was immer zur Messe stattfand und was für uns eine ganz besondere Anziehungskraft hatte – ich glaube, es war immer zur Frühjahrsmesse –, das war das Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmfestival im Casino, einem legendären Kino an der Ecke Kupfergasse/ Neumarkt. Hier traf sich die Dokumentarfilmszene der Welt. Und wir bekamen regelmäßig exklusive Filme zu sehen, die eher nicht im Kino oder im Fernsehen liefen. Aber es gab auch gute DEFA-Filme. Zum Beispiel die Indianerfilme Die Söhne der großen Bärin oder Chingachgook die große Schlange . Ich weiß nicht, wie oft ich diese Filme gesehen habe – vielleicht ein Dutzend Mal. Der Hauptdarsteller in allen zwölf Indianerfilmen war Gojko Mitic, gewissermaßen das Gegenstück zu Pierre Briece, der in den Westfilmen immer den Winnetou spielte. Gojko Mitic war Jugoslawe und in der DDR die absolute Nummer eins. Nicht nur, weil er sämtliche Stunts selbst spielte, sondern vor allem wegen seiner Glaubhaftigkeit und Souveränität. Er war der Indianer vom Dienst. Ein Indianerfilm ohne Gojko Mitic wäre in etwa so gewesen wie ein James Bond Film ohne James Bond. Aber es gab auch namhafte DDR-Schauspieler: Zum Beispiel Manfred Krug, Armin Mueller-Stahl, der nach der Wende in Hollywood Karriere machte, Hanjo Hasse und Rolf Hoppe. Ich glaube, von 1946 bis 1990 produzierte die DEFA über 700 Spielfilme. In Gohlis, wo ich wohnte, gab es seinerzeit noch zwei Kinos, die Coppi-Lichtspiele und den Gohliser Lichtspielpalast, genannt Go-Li-Pa. Doch meistens gingen wir ins Coppi. Nach jedem Indianerfilm fühlte ich mich beim Rausgehen mindestens einen Kopf größer, doppelt so stark und einfach jeder Situation gewachsen. Ich wäre ohne weiteres vom Dach des Coppikinos über die Mauer in den Hinterhof gesprungen, was ich irgendwann auch mal gemacht habe. Ansonsten fand der praktische Teil der Indianergeschichten immer bei Pönitzschs statt, einem Wildwuchsgelände am Ende unseres Hinterhofs, ein ideales Areal für Verfolgungsjagten und Abenteuer jeder Art. Und als uns das nicht mehr ausreichte, zogen wir kurz entschlossen ins Leutzscher Holz und erkundeten dort die unterirdische Kanalisation. Das war unglaublich spannend. Überhaupt war die Kindheit in den 60ern grandios. Ganz anders als heute. Abenteuerlicher und unkomplizierter. Einfach “unplugged“. Heute wundert man sich vielleicht, dass wir überlebt haben, aber es ist wirklich wahr: wir saßen in Autos ohne Sicherheitsgurte, fuhren Rad ohne Helm, und unsere Betten waren bemalt mit Farben voller Blei und Cadmium. Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und trieben uns oft den ganzen Tag lang herum. Niemand wusste, wo wir waren. Wir hatten keine Videospiele, nicht mal Filme auf Video, keine eigenen Fernseher – an 64 Kanäle war noch nicht zu denken –, ganz zu schweigen von Computern oder gar dem Internet. Wir hatten nur eines: Freunde. Sie hießen ... Uwe, Christian, Jürgen und Klaus-Dieter. Aber zuallererst muss ich von Thomas erzählen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.