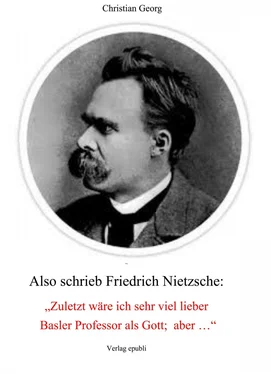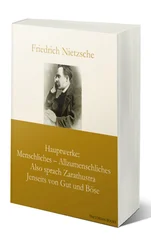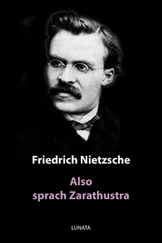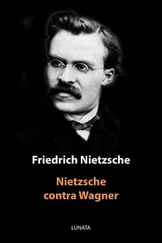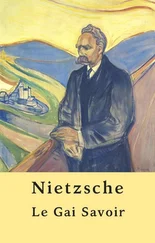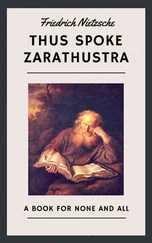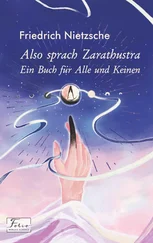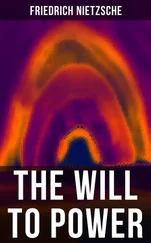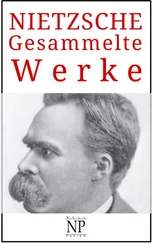Freiheit des Willens , in sich nichts anderes als Freiheit des Gedankens, ist auch in ähnlicher Weise wie Gedankenfreiheit beschränkt. [Allerdings aus jeweils völlig anderen Gründen! Hier behandelte N drei „Dinge“: die individuell gegebenen Freiheiten sowohl „des Willens“ als auch „des Gedankens“, sowie die berühmte, im problematischen Zusammenhang mit dem Absolutismus in Schillers Drama „Don Carlos“ von Marquis Posa vorgebrachte politische Forderung nach von keiner Zensur beschränkter „Gedankenfreiheit“, - ohne angemessene Unterschiede zu machen; - was nicht auf eine frühe, genialische Durchdringung dessen verweist, worüber N sich auszulassen beliebte. Die Freiheiten des „Willens“ und des „Gedankens“ finden innerhalb des Individuums, in den Anlagen seines Charakters und seiner Ausbildung sowohl ihre Entfaltungsmöglichkeiten als auch ihre Begrenzung. Darüber hinaus gibt es Förderung und Behinderung durch Umstände seitens gegebener oder nicht gegebener Bildung und praktischer Fähigkeiten zur Umsetzbarkeit und zum Realitätsbezug, um nur die auffälligsten „sonstigen Umstände“ zu erwähnen. Die „Gedankenfreiheit“ dagegen ist - gänzlich anders gelagert! - eine in gesellschaftlichen Organisationsformen enthaltene Frage politischer Moral, Toleranz und Macht.]
Der Gedanke kann die Weite des Ideenkreises [was wäre das? oder: was sollte das sein?] nicht überschreiten, der Ideenkreis aber beruht auf den gewonnenen Anschauungen und kann mit deren Erweiterung [einem Maß an Bildung? an Wissen? an Ahnung? an „Herz“ vielleicht auch? - aber sicherlich auch aufgrund von Phantasie! - und nicht zuletzt an intellektuellen Fähigkeiten!] wachsen und sich steigern, ohne über die durch den Bau des Gehirns bestimmten Grenzen hinauszukommen [was festzustellen banal war, denn unterhalb dieser - egal wo gelegenen! - „Superlativ-Grenze“, - an die zu stoßen N immerhin weit entfernt gewesen ist, da es ihm passierte, an der erstbesten in seine pastoral umschlossene Welt eintretende, von außen auf ihn wirkende Ideen- und Gedankenflut, wie die von Emerson, derart wehrlos hängen zu bleiben , wie er es tat! Schließlich gab es unterhalb der - verführt von seiner Neigung zur Maßlosigkeit! - angesprochenen physischen Barriere eine Unzahl von N völlig unbekannt gebliebenen Problembereichen, an denen er sich auf fruchtbare Weise hätte abarbeiten können. Er aber strebte zu den äußersten, Jenseitiges streifenden, superlativisch stigmatisierten Grenzen und Möglichkeiten, die zwar „denkbar“, aber eben prinzipiell weder „erreichbar“ noch überschreitbar waren und sind].
Ebenso ist auch bis zu demselben Endpunkte die Willensfreiheit [gegeben wieder durch „den Bau des Gehirns“? - oder diesmal nur im Sinne des unerreichbar Maximalen?] einer Steigerung fähig, innerhalb dieser Grenzen aber unbeschränkt. [Ergab diese Aussage einen Sinn?] Etwas anderes ist es, den Willen ins Werk zu setzen; das Vermögen hierzu ist uns fatalistisch zugemessen [durch innere und äußere Einflüsse begrenzt und als Niederreißen viel leichter gesagt und getan als das Aufbauen!]. - BAW2.60
Den Fakt hatte schon Goethe knapp und genau genug mit den „Urworten, orphisch“: „nach dem Gesetz, wonach du angetreten, so musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen“ beschrieben! - In dem von N gebrachten Umfang entsprach die Willensfreiheit ihrem Ausmaß nach eher Ns Phantasie. Zu denken wäre dabei an so maßlose Figuren, wie beispielsweise Alexander, Napoleon, Hitler und Stalin und viele andere, - aber es gilt, in positivem Sinn, auch für Menschen wie beispielsweise den „Weltvermesser“ Alexander von Humboldt, 1769-1859, ein weltweit über Europas Grenzen hinaus bedeutsamer Forscher auf so gut wie allen naturwissenschaftlichen Gebieten, der einen neuen Stand des prüfenden und vergleichenden Nachdenkens über das - in besonderer Weise auch durch ihn! - lawinenartig erweiterte „Wissen über diese Welt“ entwickelt hatte. Von dergleichen war der hinsichtlich Macht und praktischem Tatendrang wenig begabte, den Weltvergewaltigern seelisch viel näher stehende N weit entfernt. Übrigens vermitteln auch seine hier zitierten Zeilen den Eindruck, dass er nur niederschrieb, wie er sich die Welt gefühlsmäßig vorstellte und sich erklärte, ohne intellektuell zu einer ganzheitlichen Anschauung dessen in der Lage zu sein und noch weniger über sein vermeintlich „Erdachtes“ in ausreichendem Maße nachzudenken und das Formulierte auf Widersprüche und Unstimmigkeiten hinreichend überprüfen zu können. N folgte eigentlich immer nur seiner Begeisterung oder seiner Ablehnungen im Umgang mit großen Themen und Zusammenhängen, für die er aber keine geistig einigermaßen objektive Zuständigkeit besaß.
Indem das Fatum dem Menschen im Spiegel seiner eignen Persönlichkeit erscheint [den beinahe gleichen Satz gab es bereits in seinen „Gedanken“ zu „Fatum und Geschichte“. Was aber wollte er damit beschreiben? Dass der Satz zum zweiten Mal auftaucht ist zumindest ein Zeichen dafür, dass N der darin gefasste Gesichtspunkt wichtig war! Ging es wieder um Emerson-Aussprüche der Art wie „kein Mensch kann etwas lernen, wozu keine Anlagen in ihm vorhanden sind, wenngleich der Gegenstand seinen Augen nahe genug ist“? EE.109oder darum, was für N schon vor seiner Emerson-Infektion und sogar schon vor der Dokumentation seines „Herrscheramtes“ 1858 eine gegebene „Erkenntnis“ war? Nämlich dass das Leben nur ein Spiegel wäre: „In ihm sich zu erkennen, möchte ich das erste nennen, wonach wir nur auch streben“? BAW1.32
Wie dem auch sei. In strenger und bereits nachgewiesener Anlehnung an - und Wiederholung von! - Emerson, fährt N mit seinen Weisheiten zu „Willensfreiheit und Fatum im Spiegel der eignen Persönlichkeit“ fort mit dem Einwand, dass möglicherweise:] individuelle Willensfreiheit und individuelles Fatum zwei sich gewachsene Gegner sind. Wir finden, dass die an ein Fatum glaubenden Völker sich durch Kraft und Willensstärke auszeichnen, dass hingegen Frauen und Männer, die nach verkehrt aufgefassten christlichen Sätzen [so musste es ihm ohne „die Anderen“ scheinen!] die Dinge gehen lassen, wie sie gehen, da „Gott alles gut gemacht hat“ [so die Spielart, die er von „zu Hause“ kannte ! - Und doch hat seine in einigen Belangen vielleicht einfältig wirkende, aber lebenstüchtige Mutter es zu einem eigenen Haus gebracht und den Sohn als Schwachsinnigen viele Jahre lang aufopfernd gepflegt, und tapfer das Notwendige angepackt, also viel geleistet, was durchaus nicht einem „die Dinge gehen lassenden“ Lebenskonzept entsprach - denn im Großen war es gerade das christlich geprägte Abendland, welches - im Gegensatz zum sich angeblich vom Schicksal bestimmen lassenden Verhaltensweisen neigenden Kulturen - zu von N gar nicht vorstellbaren, von ihm aber in eine andere Richtung gewünschten Veränderungen aufgebrochen war. In Formulierungen wie den „nach verkehrt aufgefassten Christlichen Sätzen“ verrät sich N früh als Besserwisser mit verhängnisvollen Neigungen zu Vorurteilen, - obgleich N damit nur eine unzulässig klugscheißerische Verallgemeinerung beging, indem er folgerte, dass „ die Christen “] sich von den Umständen auf eine entwürdigende Art leiten lassen. Überhaupt sind „Ergebung in Gottes Willen“ und „Demut“ oft nichts als Deckmäntel für feige Furchtsamkeit, dem Geschick mit Entschiedenheit entgegenzutreten BAW2.60[so, wie Er es - bewehrt mit Schild und Waffen aus Emersons Rüstkammer und Arsenal - gerade tat?].
Wenn aber das Fatum als Grenzbestimmendes doch noch mächtiger als der freie Wille erscheint, so dürfen wir zweierlei nicht vergessen, zuerst, dass Fatum nur ein abstrakter Begriff ist, eine Kraft ohne Stoff, dass es für das Individuum nur ein individuelles Fatum [einen individuellen „abstrakten Begriff“?] gibt, dass Fatum nichts ist als eine Kette von Ereignissen, dass der Mensch, sobald er handelt und damit seine eignen Ereignisse schafft, sein eignes Fatum bestimmt [oder auch das vieler anderer, siehe nochmals Alexander, Napoleon, Hitler, Stalin und viele vergleichsweise andere mehr oder weniger eigenmächtige Potentaten], dass überhaupt die Ereignisse, wie sie den Menschen treffen, von ihm selbst bewusst oder unbewusst veranlasst sind und ihm passen müssen [was ein wild gemischtes, kunterbuntes Allerlei aus vielen bereits angeführten Emerson’schen Fatums-Deutungen war, - demgegenüber Ns „Logik“ dazu vorn und hinten auf mehr als nur einem Bein hinkte! Derlei aber stellte für N keine Besonderheit dar, auch später - sogar bei etlichen ihm als sehr wesentlich erscheinenden „Gedanken“ oder eher Eingebungen! - Vieles war eher nach diesem Muster gestrickt, als „philosophisch gedacht“ und auf logisch schwerlich haltbaren Grundlagen „in den Handel“ gebracht. Die folgende Aussage zeigt demgegenüber mehr „Vernunft“, war aber auch enger an eine von Emerson angelehnt:]
Читать дальше