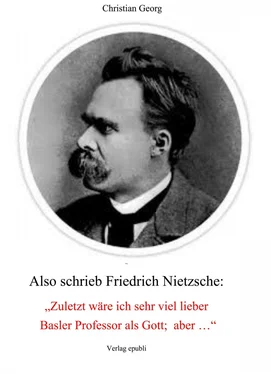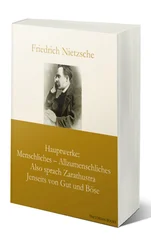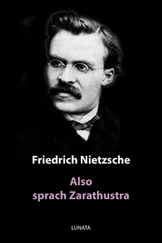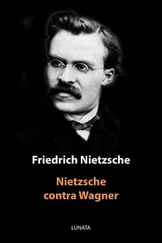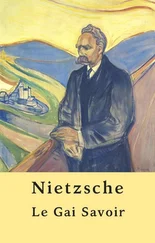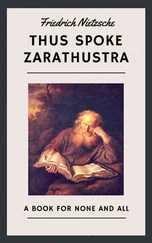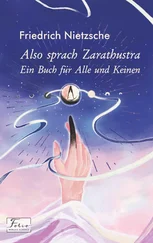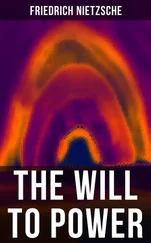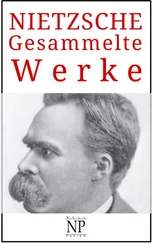Aus dem 6. Kapitel „Von der Würde und Gottesverehrung“:
So wenig, wie das Sonnensystem um seinen Ruf besorgt zu sein braucht, oder Wahrheit und Ehrlichkeit um ihre sichere Begründung [wobei das, was „Wahrheit“ ist oder sein kann, hier als ein angebliches Absolutum genommen, keinerlei Definition und schon gar keiner Fragestellung unterzogen wurde], so wenig ist es mir auch möglich, zu fürchten, dass aus festem Anlehnen an das Fatum oder an die Ideen von wirklicher Macht und jede Art von Handel eine zweiflerische Missgeburt entstehen könnte, welche durch die Lehren des Glaubens nicht in Schach gehalten würden. [Die „Festigkeit im Glauben“, die Emerson hier zeigte, könnte aber auch in der einseitigen Sichtweise auf diese Dinge liegen:] Die Stärke dieses Prinzips wird nicht nach Unzen und Pfunden bemessen: sie herrscht tyrannisch im Zentrum der Natur [was N erlaubte, diese Zwanghaftigkeit zu übernehmen, indem er auch daran glaubte, dass es - in gleicher Einseitigkeit der Betrachtung! - keine andere Sichtweise gäbe]. Wir dürfen immerhin dem Skeptizismus so viel Raum geben, als wir vermögen: der Geist wird zurückkehren, um uns zu erfüllen. Er treibt die Treiber und hält allen Kraftansammlungen und Auflehnungen das Gegengewicht. EL.140
Aus dem 7. Kapitel „Gelegentliche Betrachtungen“:
Obgleich eine gewisse Wut, Andere belehren zu wollen, mit dem Menschen zur Welt kommt [und davon spürte N ein ziemliches Potential in sich!], ist das Leben eher ein Gegenstand des Erstaunens, als der Belehrung. Es gibt so viel Fatum, so viel unwiderstehliche [weil so wenig ohne weiteres beeinflussbare!] Vorherbestimmung durch das Temperament, so viel unbewusste Eingebung darin, dass wir zweifeln, ob wir aus unsrer eignen Erfahrung etwas sagen können, das Andern helfen könnte [das konnte N nicht! - Trotzdem jedoch gab es da diese nicht zu unterdrückende, „bis zum Defekt“ NR.320sich auswachsende ehrgeizige Sehnsucht nach Größe 4.194, die sich doch irgendwie sollte erfüllen lassen!]. Alle Äußerungen sind schüchterne und gewagte Mittel. EL.170
Das belehrende Element steckte bei N in seinem ihm selbstverständlichen „Mach-es-wie-ich“ stets obenan. Auch dies entsprach Ns Gefühlslagen, als er das - und ja nicht nur einmal, sondern immer wieder mal! - las. Er kannte sowohl die „Wut der Belehrung“ wie das „Erstaunen“ und auch den „Zweifel“ ob er aus eigner „Erfahrung“ heraus etwas sagen könne und der Welt zu verkünden hätte: Etwas, das über die Selbstbespiegelung seiner immer wieder unternommenen Rückblicke auf sein eigenes Lebens hinausgehen würde!
Und so ist das ganze Leben ein schüchternes und ungeschicktes Versuchen [weil jeder in und mit seinem Leben Neuland betritt]. Wir tun, was wir können und nennen es beim besten Namen [obgleich keine oder nur herzlich wenig Orientierungshilfe gegeben wird, woran sich der Einzelne halten soll : - immer nur an sich selbst? - wie N! - Das ist zu wenig und führt, solange „die Anderen“ darin eine so geringe Bedeutung haben, in die Irre der nicht nur von N oder in seinem Sinn zu vertretenden „Freiheit des Geistes“, die bei ihm letztlich lautete „Alles ist erlaubt, nichts ist wahr“ 4.340]. Wir haben es gern, wenn man uns für unsere Handlungen lobt, aber das Gewissen sagt uns: „Es gilt nicht uns“ EL.170f[denn ein ordentlich bescheidenes Puritaner-Gewissen wie das von N hatte - anfänglich zumindest! - so selbstsüchtige Äußerlichkeiten wie lobende Anerkennung und Ruhm anstandshalber gering zu schätzen, was an Ns sehr zurückhaltende Reaktion auf die Verleihung des von der Universität Leipzig ausgesetzten Preises für eine grundlegende Arbeit „über die Quellen des Diogenes Laertius“ gemahnt. Er quittierte sie mit der Bemerkung: „Tant de bruit pour une omelette“ 1.2.68- so viel Applaus für ein Omelette - obgleich er doch stolz genug war, einem Freund den gesamten lateinisch verfassten, über 14 Druckzeilen langen Lobes-Wortlaut, welcher auf der - seine Arbeit „auf eine glänzende Weise krönenden“ - Preis-Erteilungsurkunde aufgeführt war, in sauberer Abschrift zur Kenntnis zu geben.
In dem - wegen Ns detailliert aufzuzeigender Abhängigkeit von Emerson! - an dieser Stelle erst bis gut zur Hälfte kommentierten Jugendaufsatz über „Fatum und Geschichte“, in dem N sich „in den Kreisen der Weltgeschichte mit fortgerissen“ der „Frage um Berechtigung des Individuums zum Volk, des Volkes zur Menschheit, der Menschheit zur Welt“ zugewandt und sich zugleich zu den diesem Thema möglichen Superlativen emporgearbeitet hatte, ging es ihm - wiederum sehr persönlich genommen! - um sein zentrales Problem des ihm schwer fallenden „Einordnen-Könnens“ seines gewaltigen Ich und dessen „Berechtigung“ gegenüber den ihm wegen seiner Gefühlsblindheit für sie nur schwer auszumachenden „Anderen“, die er - wenn überhaupt! - nur als „Rest der Welt“ auf der Rechnung seiner eigenen Bedeutsamkeit hatte!
Die in Aufmarsch gebrachten Superlative „Volk“, „Menschheit“ und „Welt“ waren Masken, hinter denen N seine Unbedeutenheit verstecken konnte, weil es immerhin doch - auch moralisch! - nach etwas aussah, wenn er den Anschein erwecken konnte, dass er sich für derlei zuständig fühlte. Von einer Leistung in dieser Richtung brauchte ja nicht die Rede zu sein, denn hier waren nur Worte zu investieren! An dieser Stelle seines Aufsatzes wich Er - in fraglos parteiischer Ausübung seines „Herrscheramtes“, hierzu konkrete Aussagen zu wagen! - aus, wechselte „ein wenig“ das Thema und setzte seinen Text - als würde er „bei der Sache bleiben“! - mit einer weiteren, aus seiner Lebensselbstverständlichkeit heraus ergriffenen Behauptung fort:
Die höchste [äußerste, unerreichbar superlativische] Auffassung von Universalgeschichte ist für den Menschen unmöglich; der große Historiker aber wird ebenso wie der große Philosoph Prophet [wieso? Nur wegen seiner Sehnsucht und Lust, zu bestimmen, was seinen Vorstellungen entsprechend kommen sollte?]; denn beide abstrahieren [Philosoph, Prophet und auch N ! - verallgemeinern] von inneren Kreisen auf äußere [wie im Mittelalter die Himmelsschalen, die als Sphären die Wandel- und Fixsterne „hielten“ sowie, noch ein Kreis weiter, Gottes Heimat bewahrten und von denen auch niemand wusste, wie sie außerhalb der menschlichen Vorstellung wirklich gestaltet wären]. Dem Fatum aber ist seine Stellung noch nicht gesichert [wer sollte das tun?]; werfen wir noch einen Blick auf das Menschenleben, um seine Berechtigung im Einzelnen und damit im Gesamten zu erkennen.
Was bestimmt unser Lebensglück? [gibt es denn eins? - für alle ?] Haben wir es den Ereignissen zu danken, von deren Wirbel wir fortgerissen werden? [dass N hier das „Fortgerissen-werden“ nach 14 Zeilen zum 2. Mal nannte konnte nicht ohne Bedeutung sein, weil N damit eine Gefühlslage umriss, die zumindest nicht darauf verwies, dass er „alles im Griff“ gehabt hätte, sondern im Gegenteil, ihn eher das Gefühl des „Fortgerissen-werdens“ beschlich, also nicht alles nach Wunsch „im Griff zu haben“!] Oder ist nicht vielmehr unser Temperament gleichsam der Farbenton aller Ereignisse?
Das dürfte kaum in jedem Fall klar voneinander zu unterscheiden sein! - So, wie es Ereignisse gibt, die wir nur eingefärbt durch unser „Temperament“ erleben, gibt es auch welche, die unser „Temperament“ einfärben und ihm eine Richtungsänderung aufzwingen. Und des Weiteren gibt es Etliches, das unerbittlich von außen bestimmt, was aus dem Einzelnen „werden“ kann oder auch nur „gemacht wird“, - alles in allem.
Tritt uns nicht alles im Spiegel unserer eigenen Persönlichkeit entgegen? [Das hatte N schon einige Monate vor seinem „Herrscheramts“-Erlebnis auf den Schönburg-Zinnen vermutet, als er - wohl im August 1858! - die Gedichtzeilen schmiedete: „ein Spiegel ist das Leben. In ihm [und das in engst-möglicher Rückkopplung!] sich zu erkennen, möchte ich das erste nennen, wonach wir nur auch streben“ BAW1.32[was, für sich genommen, nicht der erste Ausdruck seiner reichlich autistisch veranlagten Grundeinstellung dem Leben gegenüber war.] Und geben nicht die Ereignisse gleichsam nur die Tonart unsres Geschickes an, während die Stärke und Schwäche, mit der es uns trifft, lediglich von unserem Temperament abhängt?
Читать дальше