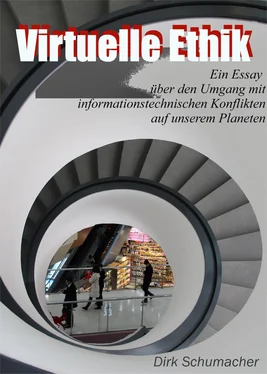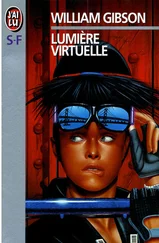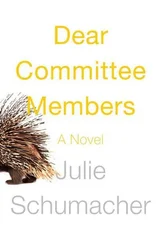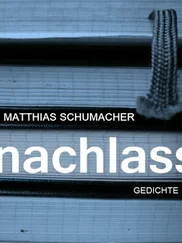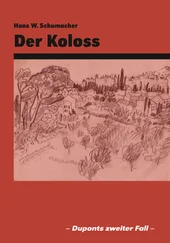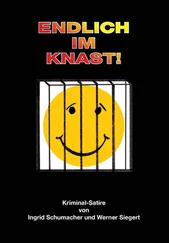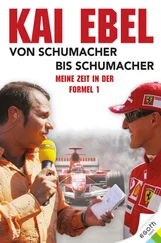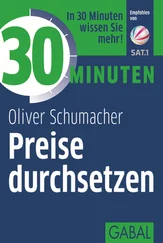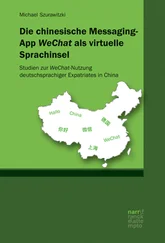Bourdieu analysiert die Interpretationen des Agrarkalenders der Kabylen und führt sie ad absurdum. Nach ihm werden folgende Fehler bei den Interpretationen gemacht. Beim Begriff lah?lal darf nicht von einem festen Zeitabschnitt dir Rede sein, weil damit ein pragmatischer Zeitraum der Feldbestellung und Aussaat gemeint ist, der sich nach der Natur richtet. Er unterscheidet bei lah?lal zwischen lakhrif , der Feldbestellung, la'laf , der Sonderbehandlung der müden Ochsen, elyali , dem Tiefpunkt des Winters, wo manche Arbeiten unstatthaft sind ( h?aram ).Wie z.B. lah?lal lafth, wo weiße Rüben gesät werden dürfen oder lah?lal yifer , wo die Feigenbäume abgelattet werden dürfen. Er erklärt verschiedene Begriffe ( thimgharine, thamgarth, amerdil, Ai?n Aghbel, furar zu maghres, und viele mehr), die Zeitabschnitte benennen, ohne das damit feste Zeitabschnitte gemeint sein, sondern sie werden aus der Natur abgelesen. Bourdieu kritisiert das standardmäßige wissenschaftliche Vorgehen einer Analyse des Kalenders, weil in ihnen praktische Widersprüche der Regeln mit mathematischen oder rhetorischen Mitteln eingeebnet werden um die theoretische Konstruktion eines Kalenders der Kabylen logisch strukturiert erscheinen zu lassen. Wobei dieser keine Logik in sich besitzt, sondern von praktischen Erwägungen in der Landbearbeitung geleitet ist. Er wettert dagegen, dass dies nicht einer wissenschaftlichen Profession entspricht, sondern einer Verbiegung des Gegenstandes der untersucht wird.
Er geht noch tiefer in die Kritik funktionalistischen Denkens. Für ihn bedeutet der Begriff der Praxis die immanente Logik eines zu beschreibenden Vorgangs auflösen, aus ihren praktischen Selbstverständlichkeiten herauslösen zu können. Jeder Wissenschaftler ist dadurch, dass er gezwungen ist in einem wissenschaftlichen Diskurs zu bestehen, auch immanent in der Ebene der rituellen Praxis der Wissenschaft gefangen und damit gezwungen der Wahrheit logische Zusammenhänge hinzu zu konstruieren, damit diese in der Logik der Theorie bestehen kann. Eine wirkliche Wissenschaft dagegen kann alleine nur die Beziehungen zwischen den zu analysierenden Gegenständen beschreiben.
Bourdieu trennt sich von einer funktionalistischen Sichtweise des Kalenders und schildert den kabylischen Kalender existierend auf einer Basis von praktischer Logik, mystischer, kosmologischer und geometrischer Komponenten, vom Umgang mit Übergängen und Gegensätzen, Unbestimmtheit, welche Symbole, Riten und mystische Elemente haben hervorbringen lassen. Zuguterletzt weist er noch auf Deutungsfehler hin, die aus den Fragestellungen nach Zeit gründen und eine Bevorzugung von islamischen Elementen der Sprache durch frühere Forscher zeigen. Allein die Frage an einen Kabylen „..und dann?“ führt zu einer Antwort, in der der Gefragte versucht seine Zusammenhänge in einen zeitlichen Rahmen zu zwängen, der in seinen Lebenszusammenhang nicht existiert, um der Fragestellung des Forschers genüge zu tun. Und da diese Fragestellungen sich leichter durch arabische Begriffe für den Gefragten erklären lassen, die eher einem zeitlichen Verlauf darstellen können, was wiederum nicht dem Wert der gesprochenen Sprache der Kabylen entspricht, werden die Darstellungen allein durch die Sprachwahl der Kabylen verzerrt. Für die bisherigen Forscher war auch das Arabische leichter zu verstehen und es folgten Erklärungen, die die Deutung dahin legten, dass die eindeutigere funktionale Sprache des Arabischen die kabylische Sprache immer mehr verdrängen würde, da diese das Verständnis komplexere modernere Zusammenhänge ermöglichte. Was aber wiederum nicht der Wahrheit entspricht, sondern eine westliche von der eigenen Überlegenheit überzeugte Auslegungsweise ist.
Ich gehe hier noch nicht auf die von Bourdieu folgende Theorie ein. Dies wird später geschehen müssen. Denn erst ist es hier wichtig, den genauen Punkt zu finden, von dem Bourdieu ausgeht, den Punkt dessen, was ihn antreibt was er versucht zu beweisen und was er später in seiner Theorie vor uns ausbreitet.
Bei der Erforschung eines sozialen Gegenstandbereiches, geht es wie bei der Erforschung einer physikalischen Gegebenheit entweder um die Verifizierung einer Theorie – oder im Laufe der Erforschung um die Aufstellung einer neuen Theorie. Beides arbeitet sozusagen Hand in Hand. Ohne vorangestellte Theorie sind keine Tests oder Forschungsarbeiten möglich. Ohne eine Theorie ist nicht einmal klar, welches Werkzeug bei der Forschung benutzt werden kann. Das bedeutet der Forscher hat eine Vorstellung davon, womit er arbeitet. Im Laufe seiner Arbeit stellt er vielleicht neue Gegebenheiten, neue Ergebnisse fest, die ihn zwingen seine Theorie zu verändern. Oder gar eine neue Theorie aufstellen lässt, die es zu ergründen gibt. Mit Hilfe von Tests, Statistiken, Versuchsaufbauten und Versuchsreihen ,wird versucht Versuchsergebnisse zu erreichen, die genau zu den aufgestellten Theorien passen. Falls genügend Versuchsergebnisse vorhanden sind, die eine Theorie stützen, kann der Forscher diese Versuchsergebnisse veröffentlichen. Können andere anhand der genau definierten Versuchsparameter diese Ergebnisse nachvollziehen, gilt die Theorie, als in der Fachwelt bestätigt. Die Theorie wird allgemein angenommen. Dieser Aufbau hat eine strukturelle innere Logik, der kaum zu widersprechen ist und die im praktischen Leben sehr überzeugend ist. Diese Art des Forschens ist etwas anderes als bloße Herstellen eines Gerätes oder Werkzeugs, welches funktioniert. Ein funktionierendes Werkzeug trägt sozusagen seine Theorie und Versuchsparameter mit sich rum. Jeder der es auseinander baut, könnte mit genügend Vorwissen seine Funktion erraten und es eventuell nachbauen. Bei Rädern ist dies sicherlich leichter als bei Computern. Aber auch dort ist es durch Reverse Engineering möglich. Forschung durch Theorie, Versuchsreihen und Überprüfung durch Kollegen ist ein soziales Vorgehen, keine eventuelles Basteln oder Spielen wie vorher. Es ist ein durch die Jahrhunderte entwickeltes Verfahren, dass es ermöglicht wissenschaftlichen Fortschritt zu produzieren, dessen Ergebnis wir überall um uns herum vorfinden.
Die funktionale Denkweise, die diese Wissenschaft erst ermöglicht hat, folgt dem logischen Kalkül des Kausalität. Kausalität ist etwas, was man lernen und weitergeben kann. Und diese bezieht nicht nur physikalische Gegenstände und Gegebenheiten mit ein, sondern auch Personen und jedwede Handlung, die diese begehen können. Es ist eine Sichtweise die, worauf Gergen aufmerksam gemacht macht, es ermöglicht das Ich als soziale Konstruktion zu erkennen. Als etwas, was der Kausalität unterliegt. Genauso, wie die funktionale Sichtweise es ermöglicht Teile des Bewusstseins logisch funktional aufeinander zu beziehen und mit Eigenschaften zu versehen. Das menschliche Bewusstsein sozusagen auszudifferenzieren in Ich, Über-Ich, Eros und Todestrieb. Oder gar in die physikalischen Bestandteile des Bewusstseins, wie sie sich im Gehirn widerspiegeln. Im Bewusstsein des assoziativen Cortex in der Rückkopplung mit den emotionalen Zuständen des limbischen Systems. Die Auswirkungen gehen so weit, das die Menschen sich heute so verstehen, wie es die Wissenschaft ausdrückt, kausal, visuell geometrisch orientiert, in Testreihen. In Zeitschriften geht es darum, wie man seine Gehirnhälften besser ausnützen kann. In Berufseignungstests geht es nicht um soziale Fähigkeiten, sondern um visuelle Vorstellungsmöglichkeiten und Merkfähigkeiten. Kriminalfälle werden nicht aufgrund von Indizien, sondern durch logische Ketten bewiesen. Sprache wird nicht als ein Netzwerk zur Kommunikation, sondern als ein logischer Aufbau von Satzbauteilen verstanden. So ist es schon schwierig von Forscher zu erklären, wieso sich Sprachen überhaupt ändern können. Wirtschaftliche Prozesse werden aufgrund von statistischen Prozessen erklärt.
Читать дальше