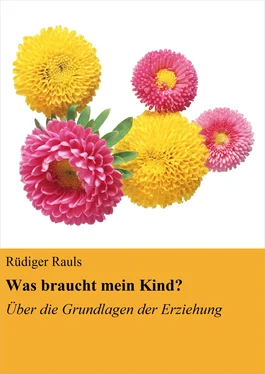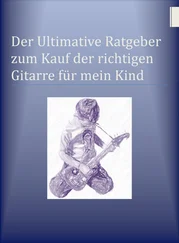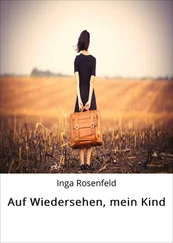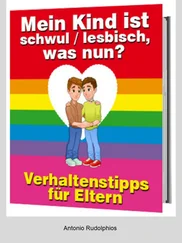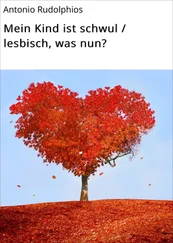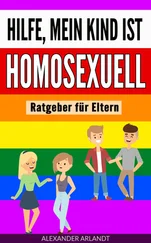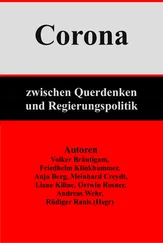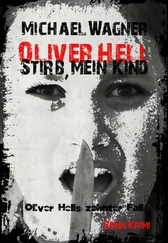Denn die Versorgung der Nachkommenschaft im Stile der Säugetiere ist sehr viel aufwendiger im Vergleich zu derjenigen früherer Lebensformen, da sie das Leben der Eltern erheblich einschränkt und zusätzlichen Gefahren aussetzt. Dieses Konzept kann nicht funktionieren, wenn die Elterngeneration die eigene Brut als die Belastung empfindet und sie deshalb vernachlässigt oder gar ablehnt.
So werden alle anderen Entwicklungsstränge, die diese Verbindung von körperlicher und emotionaler Nähe nicht herausbilden konnten, gescheitert und abgestorben sein. Vermutlich sind alle existierenden Säugetierarten nur ein dünner Bodensatz all der Mutationen, die sich nicht hatten halten können, weil ihnen die wesentliche Grundbedingung fehlte, die Ausstattung mit einem der Aufgabe entsprechenden emotionalen Instrumentarium.
Dieses Instrumentarium fassen wir im Bereich der menschlichen Gattung unter dem weiteren Begriff der Liebe zusammen. In diesem Begriff sind Einstellungen und Verhaltensweisen wie Fürsorge, Opferbereitschaft, Verantwortung, Beschützer“instinkt“ und viele andere mehr zusammengefasst
Die Säugetiere konnten unter den mörderischen Bedingungen der Konkurrenz um Nahrungsmittel nur überleben, weil in ihnen Instanzen entstanden waren, die dem Überleben der Gattung den Vorrang gaben vor dem Überleben des Individuums, indem die Eltern sich aufopfern für die Brut. Die Eltern sind bereit das eigene Leben zu opfern für das Überleben der Kinder. Ohne diese Einstellung hätten die an Nachkommenschaft geringen Säugetiere nicht überleben können.
Die starke emotionale Bindung an die eigene Nachkommenschaft macht gegenüber früheren Entwicklungsschritten der Lebensformen die Stärke der Säugetiere aus und ganz besonders in der unter ihnen am weitesten vorangeschritten Lebensform, dem Menschen. Die Liebe war neben der Hand und dem Gehirn die entscheidende Voraussetzung für die Erfolgsgeschichte Mensch. Ohne sie hätten die Vorteile, die die Verfeinerung von Hand und Hirn für die menschliche Gattung mit sich gebracht hatten, nicht weitergegeben und als Gemeingut der menschlichen Gattung erhalten werden können. Und ohne diese Weitergabe an Erfahrung und Wissen wäre es fraglich gewesen, ob auch die Entwicklung von Hand und besonders Hirn so schnell hätte voranschreiten und solch eine Perfektion hätten erreichen können.
Die Liebe ist es, was den Menschen ausmacht. Dahin drängt seine Entwicklung. Der Mensch will Liebe sein. Der Mensch will gut sein. Darin drückt sich nicht nur das Menschliche im Menschen aus, sondern auch gleichzeitig das Göttliche. Die entwicklungsgeschichtliche Aufgabe des Menschen ist es, das Göttliche im Menschen zu erkennen, in sich selbst und nicht in einem Wesen, das er außerhalb von sich selbst als Gott gesetzt hat. Dieses Göttliche in sich selbst gilt es, herauszuarbeiten und Wirklichkeit werden zu lassen. Das bedeutet, das Göttlich-Menschliche oder Menschlich-Göttliche in der Welt umzusetzen, zum Prinzip werden zu lassen, das die Welt beherrscht. Das Mittel dazu ist die Liebe, die Liebe zu sich selbst als Individuum, zu sich selbst als Gattung und zur Welt, die ihn umgibt und ohne die er nicht leben kann. Denn er ist nur Bestandteil dieser Welt und nicht ihr Beherrscher, als der sich der heutige Mensch noch weitgehend ansieht und fühlt.
Erziehung und Gesellschaft
Erziehung findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist eingebunden in gesellschaftliche Bedingungen, in einen gesellschaftlichen Rahmen. Der Mensch ist einerseits geprägt von seiner Entwicklungsgeschichte und seinen Genen. Diese menschliche Entwicklungsgeschichte lief in den größten Teilen ihrer bisherigen Existenz als unwillkürliche ab, nicht beeinflusst vom Willen des Menschen selbst. Äußere Einwirkungen auf ihn haben ihn bisher länger und nachhaltiger geprägt als der Ausfluss seines Willens. Dennoch aber sind die Ergebnisse seines Willens und seiner Denkfähigkeit die auffälligeren. Sie haben nicht nur ihn selbst sondern auch seine Umwelt und die Erde als seinen Lebensraum sehr stark verändert.
Andererseits ist der Mensch ein soziales Wesen, was hier so zu verstehen ist, dass er nur in Gesellschaft überleben kann. Das betrifft nicht nur die modernen Gesellschaften sondern auch die Frühzeit der menschlichen Gattung. Auf diesem Niveau war der Zwang zur Gesellschaftsbildung und Zugehörigkeit des einzelnen zu dieser Gesellschaft überlebenswichtig. Die harten Lebensbedingungen und die Gefahren der sie umgebenden Natur ließen keine andere Wahl. Das Individuum, auf sich alleine gestellt, hatte kaum Überlebenschancen.
Aber auch der Mensch der modernen Gesellschaften irrt, wenn er mitunter glaubt, ohne die anderen auskommen zu können. Dieses Trugbild ist der Isoliertheit des modernen Menschen geschuldet. Die direkte Abhängigkeit, wie wir sie aus früheren Entwicklungsabschnitten kennen, ist in der modernen Gesellschaft nicht mehr so augenfällig. Und dennoch ist der moderne Mensch immer noch eingebunden und abhängig von einer Gesellschaft um ihn herum, die alles das bereitstellt, was er braucht, um einerseits überleben zu können und sich trotzdem unabhängig zu fühlen. Er nimmt die Abhängigkeit nicht mehr in dieser Direktheit wahr, wie das unsere Vorfahren in den frühen Gesellschaftsformen erlebt haben dürften. Für den modernen Menschen stellt sich diese Abhängigkeit nur noch als ein Dienstleitungsverhältnis dar. Aber selbst ohne diese „Dienstleister“ wäre er hoffnungslos verloren. Zwar kann er sich aus einem breiten Spektrum den individuellen Dienstleister z.B. als Zahnarzt auswählen, auf die „Dienstleistung Arzt“ selbst kann er aber nicht verzichten. Die direkte Abhängigkeit der Gesellschaftsmitglieder untereinander, wie wir sie aus frühzeitlichen Gesellschaften kennen, ist gewichen der diskreten Verwobenheit aller Gesellschaftsmitglieder untereinander. Insofern ist die Unabhängigkeit, die wir in unseren modernen Gesellschaften gewonnen zu haben glauben, ein Trugbild.
Da der Mensch ein soziales Lebewesen ist, so ist auch Erziehung weitgehend bestimmt durch die Gesellschaft. Sie wirkt nicht nur durch die Gesetze auf die Erziehung ein sondern auch durch ihre Wertvorstellungen, Regeln, Tabus, Ansichten und das Selbstbild, das sie von sich selbst hat und das die Individuen von sich selbst und den Gesellschaften haben, deren Mitglied sie sind. Diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht starr, sondern sie verändern sich im Laufe der Zeit. Wenn sich die Grundlagen eines Gemeinwesens verändern, ändert sich auch das Weltbild, das auf diesen Grundlagen ruht.
Die Weltbilder der einfachen frühen Gesellschaften waren einfach, weil die Gesellschaften selbst sehr viel kleiner waren als die modernen der hoch entwickelten Industriegesellschaften. Die Menschen der Frühzeiten standen in einem direkten Austauschverhältnis zur der sie umgebenden Natur. Die Gefahren, die sie bedrohten, gingen aus von dieser Natur, der sie hoffnungslos unterlegen waren. Sie hatten kaum Möglichkeiten, ihren Kräften zu widerstehen. Sie waren gezwungen, sich der Natur anzupassen, sich ihren Kräften zu unterwerfen und ihr eigenes Verhalten auf die Gefahren einzustellen. Gesellschaften, die diese Überlegenheit der waltenden Kräfte ignorierten, waren dem Untergang geweiht.
Mit der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften änderte sich dieses Verhältnis zur Natur. Sie wurde beherrschbarer. Damit trat die Natur als Gefahrenquelle immer mehr in den Hintergrund. Zunehmend wird die Gesellschaft selbst zur größten Gefahr für das Individuum. Zwar stellt sie alles bereit, was der Mensch zu einem komfortablen Leben braucht, besonders in den reichen Industriegesellschaften. Auf der anderen Seite aber ist die einfache Klarheit des Zusammenlebens, wie es noch in den einfachen Gesellschaften der Frühzeit geherrscht hat, verloren gegangen. Das Leben ist kompliziert geworden. Die Welt ist nicht mehr so einfach zu verstehen, wenn es auch durch die Gesellschaftsbildung einfacher geworden ist, in ihr zu überleben.
Читать дальше