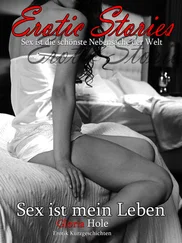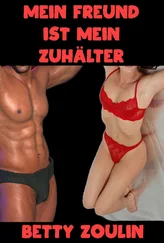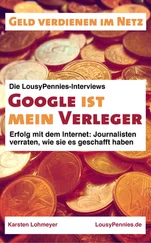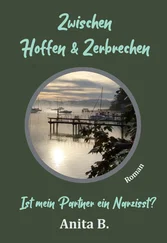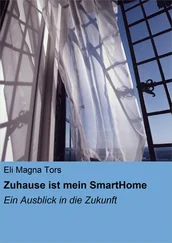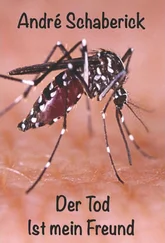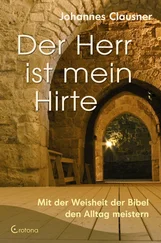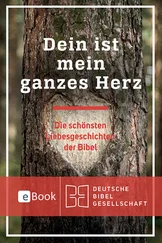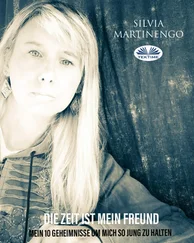Aber es gibt noch eine weitere, wichtige Unterscheidung des Glücksempfindens, die nach meiner Erfahrung viel zu wenig Beachtung findet: Uns kann etwas glücklich machen - meist ein Erlebnis, also etwas das „ von außen “ kommt und das wir „empfangen“ - oder wir können glücklich sein . Dann liegt die Quelle des Glücks in uns und wir sind der Verursacher.
Wie wir dieses Glücklich-Sein erreichen können? Die Antworten auf diese Frage bilden den Kern dieses Buches. Denn wenn wir erkennen, wie wir uns selbst glücklich machen - also in den Zustand des Glücklichseins versetzen - können, dann haben wir den Schlüssel in der Hand, der uns in die Lage versetzt, unser Wohlbefinden unabhängig von den äußeren Umständen zu steigern und auf einem hohen Niveau zu halten.
Dabei geht es keineswegs darum, ständig und ohne Unterbrechung auf „Wolke 7“ zu schweben. Das ist auch kaum möglich, denn das Glück lebt quasi von den Gegensätzen. So wie wir „hell“ nur im Kontrast zu „dunkel“ wahrnehmen können, braucht das Glück auch Phasen, in denen es weniger ausgeprägt ist, damit wir es erkennen. Auf diesen wichtigen Punkt werden wir bei unserem Ausflug in die Hirnforschung noch einmal zurück kommen.
Fragt man Menschen nach ihrer Definition des Begriffes „Glück“, bekommt man sehr unterschiedliche Antworten. Zufriedenheit , Wohlfühlen oder innerer Frieden werden ebenso genannt wie Extase oder der Zustand des Verliebtseins .
Glück scheint also etwas zu sein, was von verschiedenen Menschen unterschiedlich empfunden und wahrgenommen wird: Jeder empfindet Glück anders und jeder empfindet etwas anderes als Glück.
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Begrifflichkeiten wird in der Glücksforschung anstelle des Begriffes „ Glück “ meist der Begriff „ Subjektives Wohlempfinden “ verwendet.
Als relativ junge Forschungsrichtung beschäftigt sich die Glücksforschung seit den 1980er Jahren mit der Erforschung der Bedingungen, die Menschen glücklich machen. Hier arbeiten Psychologen, Hirnforscher, Philosophen, Sozialforscher, Wirtschaftswissenschaftler, Biologen, Politikwissenschaftler und Fachleute aus anderen Gebieten intensiv und interdisziplinär zusammen.
Ein wesentliches Werkzeug der Glücksforscher ist die Befragung. Mittels mehr oder weniger ausgeklügelter und umfangreicher Fragebögen werden die Menschen nach ihrem aktuellen oder zurückliegenden Glückserleben befragt. Dabei zeigen sich trotz aller kultureller Unterschiede auch einige grundlegende Gemeinsamkeiten, die anscheinend auf der ganzen Welt Menschen glücklich machen. Im Kapitel „ Was macht glücklich? “ werden wir ausführlich darauf eingehen.
Einen anderen Weg geht die Hirnforschung, die mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) und Hirnstrommessung (EEG) die Aktivität des Gehirns während bestimmter Experimente beobachtet. Die Forscher erlangen so Aufschluss darüber, wie ein Glücksgefühl im Kopf entsteht und welche Hirnbereiche und Botenstoffe dabei beteiligt sind. Das Kapitel „ Wie funktioniert Glück? “ berichtet von den aktuellen Erkenntnissen der Hirnforscher.
Im Laufe der Zeit haben die Glücksforscher drei Faktoren herausgefunden, die maßgeblichen Einfluss auf das subjektive Glücksempfinden eines Menschen haben.
Der wichtigste dieser drei Faktoren – und das mag Sie jetzt erst einmal deprimieren, lieber Leser – sind anscheinend unsere genetischen Veranlagungen.
Forschungen, welche die beiden amerikanischen Zwillingsforscher David T. Lykken und Auke Tellegen ab dem Jahr 1994 durchführten, ergaben, dass unsere generelle Fähigkeit, Glück zu empfinden, zu etwa 50% von unseren Veranlagungen abhängt 1. Dabei spielen sowohl genetische Faktoren als auch angeborene Persönlichkeitseigenschaften eine wichtige Rolle.
Bei den genetischen Faktoren handelt es sich vor allem um die Fähigkeit, die auch als Glücksbotenstoffe bezeichneten Neurotransmitter Dopamin , Oxytocin und Serotonin zu produzieren. Menschen unterscheiden sich aufgrund ihrer Erbanlagen sowohl hinsichtlich der Menge der Botenstoffe, die vom Körper produziert werden können, als auch der hinsichtlich der Rezeptoren , die diese Glücksbotenstoffe aufnehmen und entsprechende Reaktionen im Körper auslösen. Rezeptoren sind Zellen, die chemische oder physikalische Reize in eine für das Nervensystem verständliche Form bringen.
Auf die genetischen Faktoren haben wir leider keinen Einfluss. Aber glücklicherweise ist es weniger dramatisch, als es sich anhört. Eine erhöhte Menge an Glücksbotenstoffen führt nämlich keineswegs automatisch zu einem erhöhten Glücks empfinden , da im Laufe der Zeit ein „Gewöhnungseffekt“ auftritt, der den Vorteil einer erhöhten Menge ausgleicht. Und da das Glück sehr individuell wahrgenommen wird, ist fraglich, ob alle Menschen für gleiches Glücksempfinden die gleiche Menge an Neurotransmittern benötigen.
Bei den angeborenen Persönlichkeitseigenschaften haben vor allem zwei Charakterzüge prägenden Einfluss - Extrovertiertheit und Neurotizität: Extrovertierte Menschen (eigentlich extr a vertiert von lat: extra = außen und vertere = wenden), also Menschen, die „nach außen gewandt“ sind, sprich kontaktfreudig, gesellig, aktiv und abenteuerlustig, haben es leichter, Glück zu empfinden. Dies ist leicht nachvollziehbar, weil – wie wir noch sehen werden – soziale Kontakte ein wichtiger Baustein eines glücklichen Lebens sind. Das Gegenteil dazu wären introvertierte, also „nach innen gewandte“ Menschen.
Neurotische Menschen hingegen, die von ihrem Wesen her eher ängstlich, reizbar, nervös und launisch sind, haben es verständlicherweise schwerer damit, Glück zu erleben. Aber auch hier ist es so, dass es für diese Menschen vielleicht schwerer aber keinesfalls unmöglich ist.
Wie gesagt, machen diese beiden Faktoren etwa 50% unserer Fähigkeiten aus, Glück zu erleben.
Von den verbleibenden 50% bestimmen zu weiteren 10% unsere Lebensbedingungen das persönliche Glücksempfinden. Ob wir in einem armen oder einem reichen Land leben, in welcher sozialen Schicht wir geboren wurden, welche Bildung wir erfahren durften oder ob wir gesund oder krank sind, gehören beispielsweise dazu. Auch auf diese Faktoren haben wir relativ wenig direkten Einfluss.
„Na prima, dann kann ich das Buch ja gleich zuklappen“, mögen Sie jetzt denken. Langsam, langsam, denn nun kommt die gute Nachricht: Es bleiben immerhin noch 40%, die dem direkten Einfluss unseres freien Willens unterliegen! 40%! Stellen Sie sich vor, was für ein gewaltiges Glückspotential darin steckt. Und dieses liegt in ihrer Hand und steht größtenteils unter Ihrer Kontrolle!
Bevor wir jedoch dazu kommen, wie Sie für sich dieses riesengroße Potential erschließen können, ist es notwendig, dass wir uns noch etwas vertiefter mit den verschiedenen Gesichtspunkten des Glücks beschäftigen. Nur so können wir stabile Grundlagen für dauerhaften Glücks-Erfolg schaffen. Haben Sie also bitte noch etwas Geduld.
Unser subjektives Glücksempfinden ist zu einem Teil immer auch gesellschaftlich geprägt. Daher werden wir im nächsten Kapitel zuerst der Frage nachgehen, welche Gedanken sich die Menschen im Europa früherer Zeiten über das Glück gemacht haben.
Das Glück im Spiegel der Zeit
Die großen Denker
Das Streben nach Glück hat zu allen Zeiten im Bewusstsein der Menschheit einen bedeutenden Raum eingenommen. Da ist es selbstverständlich, dass sich schon die Philosophen der Antike zu diesem großen Thema Gedanken gemacht haben.
Читать дальше