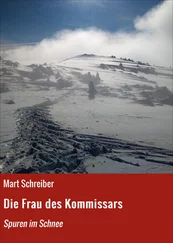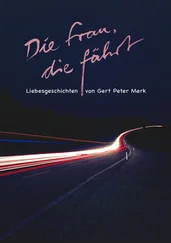Christiane Schünemann
Die Frau im Eismantel
Erzählung
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Christiane Schünemann Die Frau im Eismantel Erzählung Dieses ebook wurde erstellt bei
Prolog
Kirschblüten
Neuschnee
Harnisch
Hexenbrauen
Frost
Ingwerwasser
Theaterdonner
Blutstein
Scherben
Doña Rosita
Fremde
Ritual
Schwarze Farbe
Nestflüchter
Ranz
Traumpaar
Eiswürfel
Mandelblüte
Eleonore
Doña Natalie
Lockjagd
Grau
Nebel
Melodie
Kram
Moment
Schmerz
Verwandlung
Eismantel
Kirschblüten
Impressum neobooks
Auf dem Heimweg von der Penne hatte Walther noch immer den Satz im Ohr, den der Mann im schlecht geschnittenen Präsent-20-Anzug in Anwesenheit des Direktors gesagt hatte: Sie wollen doch studieren, junger Mann! Sie wollen doch studieren, junger Mann! Als ob er eine Schallplatte hörte, die einen Sprung hatte. Zu Hause knallte er die Schultasche auf den Boden. Seine Oma stand plötzlich neben ihm, er hatte sie nicht kommen hören. Er erschrak, als er ihr bleiches Gesicht sah.
Sie hielt einen Brief in den zitternden Händen. »Walther ... ein Brief von drüben ... für dich.«
»Ein Brief von drüben ... für mich?«
»Ich kenne keine Maria Smilonsky, die in der Eggersallee zwei in Hamburg wohnt. Bin nie dort gewesen ... vor dem Mauerbau, aber ...«
»Aber?«
»Schau mal! Es ist die Handschrift deiner Mutter.« Sie gab ihm den Brief.
Für Walther Winter stand darauf, Blücherstraße 69, x25 Rostock . Die Schleifen der W s in seinem Namen sahen tatsächlich so aus wie von ihr geschrieben. Ja, es war unverkennbar ihre Handschrift! Er fühlte die Hitze im Gesicht.
»Entschuldige, ich muss mal kurz allein sein.« Er stürzte an ihr vorbei und lief in sein Zimmer. Dort warf er den Brief auf den dunklen schweren Schreibtisch und trat gegen den Sockel, aber er tat sich nur weh. Er wanderte im Zimmer umher, drei Schritte zur Terrassentür, fünf Schritte zur Tür, sieben Schritte zurück zum Schreibtisch, immer vorbei an dem dunklen Bücherregal.
Die Sekretärin hatte ihm heute mit flatternden Lidern die Tür zum Direktorenzimmer aufgehalten. Direktor Bockholdt, von dem alle Schüler wussten, dass er ein Verhältnis mit der Englischlehrerin Miss Daduna hatte, und der ihm in der vergangenen Woche eine Fünf in Staatsbürgerkunde gegeben hatte, weil Walther der Meinung war, dass Konkurrenzkampf das Geschäft belebt, stand die glänzende Stirn mit dem Taschentuch tupfend neben einem fetten Mann, der sich als Ich-bin-der-Herr-Ziermann vorstellte. Der Mann öffnete den Anzugknopf, das Hemd spannte über dem fetten Bauch, und setzte sich an den Sprelacarttisch. »Setzen Sie sich, ich muss mit Ihnen über Ihre Eltern reden.«
Bockholdt nahm ebenfalls Platz.
Walther setzte sich mit klopfendem Herzen auf die Stuhlkante.
Ich-bin-der-Herr-Ziermann blätterte im Notizbuch. »Sie sind also Walther Winter, geboren am 13. August 1954 in Rostock?«
»Ja.«
»Ja! Sie leben seit dem vergangenen Sommer bei Ihren Großeltern väterlicherseits?«
»Ja.«
»Ja! Wo sind Ihre Eltern?«
»Ich weiß es nicht.«
Ich-bin-der-Herr-Ziermann sah ihn streng an. »Sie wissen es nicht?«
»Nein.«
»Nein!«
»Zuerst war mein Vater weg, dann meine Mutter. Einfach verschwunden.«
»Und das soll ich Ihnen glauben?«
»Ja.« Seine Wangen glühten. Das taten sie immer, wenn er beschuldigt wurde, egal, ob er schuldig war oder nicht.
»Ja!« Er blätterte wieder im Notizbuch.
Bockholdt putzte die Brille mit dem stirnfeuchten Taschentuch. Er spuckte auf die Gläser, als ob Fliegendreck daran klebte.
»Sie stehen kurz vor dem Abitur. In einem Gespräch mit Ihrem Klassenlehrer haben Sie gesagt, dass Sie gern Zahnmedizin studieren wollen. Ist das so?«, fragte Ich-bin-der-Herr-Ziermann.
»Ja.« Walther schob verlegen die wilden Locken hinters Ohr.
»Ja! Nun, das war’s für heute. Sie können jetzt gehen.«
Walther stand zögernd auf. »Auf Wiedersehen?«
»Auf Wiedersehen! Aber gewiss doch, wir sehen uns wieder. Sie wollen doch studieren, junger Mann!« Ich-bin-der-Herr-Ziermann hatte feist gegrinst.
Walther trat an die Terrassentür und blickte zum Garten hinaus. Das Kirschbäumchen trug die ersten Knospen. Das Bäumchen hatte er mit seinem Opa im letzten Frühjahr gepflanzt. Damals war er nur zu Besuch bei seinen Großeltern gewesen. Nun wohnte er bei ihnen, ein Dreivierteljahr schon. Sie hatten ihm das Gartenzimmer gegeben mit den beiden großen Fenstern und der Terrassentür, damit er viel Licht zum Lernen hatte. Und sie bemühten sich, seine Eltern zu ersetzen, so gut sie es vermochten. Was aber waren das schon für Eltern, die ohne ein Wort gegangen waren?
Entschlossen ging er zum Schreibtisch.
Er nahm den Brief seiner Mutter und tütete ihn in einen leeren Umschlag, adressierte ihn ohne Absender an Maria Smilonsky, Eggersallee zwei in Hamburg und klebte eine Briefmarke darauf. Dann hörte er wieder die Schallplatte mit dem Sprung: Sie wollen doch studieren, junger Mann! Sie wollen doch studieren, junger Mann! Er schlug mit der Faust auf den Brief.
Die Unruhe trieb Natalie um die Staffelei mit der weißen Leinwand und den beklecksten Tisch mit den Farben und Pinseln, Bürsten und Spachteln, wieder und wieder. Vor der Terrassentür hielt sie inne und blickte hinaus. Der Winter hatte ein weißes Tuch über den Garten gelegt, auch über die Terrasse und die Treppe hinab in den Garten.
Schon Ende November hatte es das erste Mal geschneit. In drei Monaten erst würde der knorrige Kirschbaum mit den kahlen vereisten Zweigen wieder blühen. Sie sehnte sich nach den Blüten. Sie sehnte sich nach den Bienen, die summend um die Blüten schwirrten. Sie sehnte sich nach den weißen Laken, die an der Leine über der Wiese im Wind schlugen, auch wenn ihre verstorbene Mutter einmal gesagt hatte: »Es ist gut, wenn die Wäsche einmal durchfriert.«
Bald schon würde die Dämmerung hereinbrechen, sie musste anfangen, wenn sie noch mit Tageslicht malen wollte. Sie ging zum Regal, das vollgestopft war mit Büchern, Kunstkatalogen, CDs und der Musikanlage. Sie schob die CD von Debussys La Mer in die Anlage und schaltete den Endlos-Modus ein.
Eine Weile lauschte sie der Musik. Die Wellen türmten sich auf und klatschten an das Ufer. Dort brachen sie und zogen sich wieder ins Meer zurück. Was für eine Unruhe in der Musik war. Sie war auch voll dieser Unruhe, voll Versagensangst. Die Angst kam mit jedem neuen Bild zurück. Dabei hatte sie in all den Jahren gelernt, dem Prozess des Malens zu vertrauen. Ihre besten Bilder waren nicht entstanden, wenn sie malte, sondern, wenn das Bild sich von ihr malen ließ.
Natalie nahm den Ehering und die Armbanduhr ab und legte beides vor die silberne Schatulle auf den schweren dunklen Schreibtisch, dessen fehlenden Sockel sie durch zwei Kunstkataloge ersetzt hatte. Sie zog das Haargummi aus der Tasche ihrer Jeans und band die glatten braunen Haare zu einem Knoten. Sie ging zum Tisch und mischte die Farben. Am liebsten malte sie mit Acrylfarben, weil sie wasserlöslich waren, und weil man sie sowohl dick als auch dünn auftragen konnte. Sie mischte mehr Farbe an, als sie brauchen würde. Als Anfängerin war es ihr ein paar Mal passiert, dass die Farben nicht gereicht hatten, und beim Nachmischen hatte sie die Töne nicht wieder getroffen. Die schwarze Farbe würde nur noch für dieses Bild reichen, sie musste neue kaufen.
Читать дальше