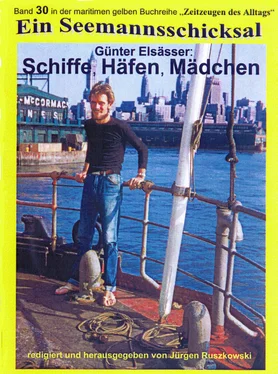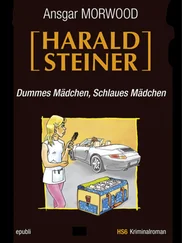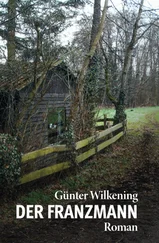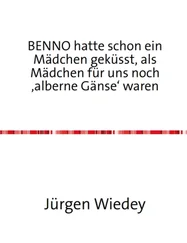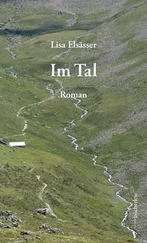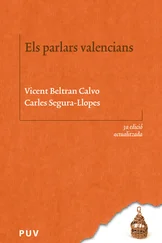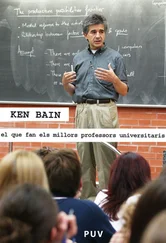Die weitere Reise und auch die nächsten verliefen immer im gleichen Rhythmus wie die erste, fast die gleiche Fracht, hauptsächlich VW-Käfer und irgendwelche Maschinen, dazu einige Passagiere, die auf Europabesuch waren und wieder in ihre Heimat zurück wollten.
Manchmal wurden noch andere Häfen, wie Santa Marta in Kolumbien und Esmeraldas in Ecuador angelaufen, jedoch wurden die Unterschiede zwischen den Städten und Ländern von uns kaum mehr wahrgenommen, die Bevölkerung war vom Charakter und der Hautfarbe überall gleich.
So ging manche auf See geführte Diskussion hauptsächlich darum, welche Frau in welcher Bar und welcher Stadt zu Hause war.
Bei jeder Ausreise mussten die Tanks und Bilgen sowie die Rohrleitungen unter den Flurplatten gereinigt und gestrichen werden, auf der Rückreise die sichtbaren Wände und Maschinenteile, vom Oberlicht bis zum Maschinenstand, was die angenehmere und leichtere Arbeit war.
Die schlimmste Arbeit war das Reinigen der Doppelbodentanks: unten der Atlantik, durch vielleicht zehn bis zwölf Millimeter dickes Blech getrennt, und oben dröhnten die laufenden Maschinen.
In die Tanks kam man nur durch den Einstieg in die Mannlöcher und kriechend von Raum zu Raum. Die einzelnen Abteilungen maßen ungefähr eineinhalb Meter in der Länge und Breite und ungefähr einen Meter in der Höhe.
Eine Belüftung gab es nicht, so dass die Temperaturen in diesen engen Tanks über fünfunddreißig Grad lagen. In einer Hand eine Kabellampe, in der anderen einen Eimer mit Spachtel, Drahtbürste und Putzlappen waren drei bis vier Mann mehrere Tage damit beschäftigt, die Tanks so zu reinigen, dass wieder neues Öl eingefüllt werden konnte. Es war eine der vielen mehr oder weniger unsinnigen Arbeiten an Bord, denn das Öl wurde sauber eingefüllt und beim Auspumpen durch feine Filter zu den Schmierstellen gedrückt.
Von den Ingenieuren ließ sich während der Reinigung keiner im Tank sehen, doch wurde die Arbeit am Schluss abgenommen und die Deckel wieder auf die Mannlöcher geschraubt.
Bei der dritten Reise waren die immer gleichen Arbeiten schon langweilig geworden. Ein von mir angestrebter Aufstieg zum Schmierer oder gar Ing.- Assistenten wurde vom Chief abgelehnt, da ein Aufstieg vom Maschinenjungen zum Unteroffizier in so kurzer Zeit und auf dem gleichen Schiff noch nie vorgekommen sei.
So ging es bei spätherbstlichem Wetter und teilweiser rauer See, welche mich jedoch auch nicht mehr störte, Richtung Hamburg.
Mein Interesse an den bei der ersten Reise in Kolumbien erworbenen Schildkröten hatte ebenfalls stark nachgelassen, sie machten nur noch Arbeit, so dass ich sie loswerden wollte. Da es an Bord keine Abnehmer gab, musste ich versuchen, sie bei unserer nächsten Ankunft in Hamburg zu verkaufen. An Bord war nach dem Festmachen ein Münztelefon installiert worden, und auch ein Branchenbuch war vorhanden. So rief ich mehrere Tierhandlungen an und beschrieb meine Schildkröten als zahme schöne Tiere in den besten Farben und gab meine Preisvorstellung bekannt.
Das Interesse war nicht sehr groß, doch war die Firma Fockelmann in der Mönkebergstraße bereit, mir pro Stück fünf Mark zu bezahlen, wenn die Tiere meinen Angaben entsprachen und ich sie vorbei bringen würde.
So steckte ich jede der Schildkröten in eine Jackentasche und marschierte Richtung Hafenausgang und Zollkontrolle. Da es jedoch den Beiden in meiner Tasche nicht besonders gefiel, versuchten sie ständig an das Licht zu kommen. Mit den beiden Händen in der Tasche versuchte ich ihre Flucht zu verhindern, was auch bis zum Erreichen des Zolldurchgangs ganz gut klappte. Ausgerechnet hier biss mir die eine kräftig in den Finger, ich konnte nur kurz reagieren und schaffte es trotzdem, den Zoll ohne Kontrolle zu passieren.
Bei Fockelmann war der Chef nicht anwesend, die genaue Art der Tiere konnte auch nicht bestimmt werden, so dass einiges Reden nötig war, um meine beiden Kameraden los zu werden und die vereinbarten zehn Mark zu kassieren.
Bis heute weiß ich nicht, um welche Spezies es sich bei den Tieren gehandelt hat und ob sie mir oder der Firma Fockelmann zu einem guten Geschäft verholfen haben.
Mitte Dezember verließ das Schiff wieder Hamburg, und für mich stand fest, dass ich nach dieser Reise abmustern würde, da der Liniendienst zwischen Hamburg und Südamerika mit immer den gleichen Häfen keinen Reiz mehr für mich hatte.
Kurz vor Heiligenabend sahen wir in der Ferne die ersten Inseln der Karibik. Das Wetter war so düster wie die Stimmung an Bord.
Obwohl die Kühlräume voll waren, sparte der Koch bei der Verpflegung der Mannschaft, wo er konnte. Beschwerden beim Kapitän wurden von diesem mit dem Hinweis auf die Verpflegungsgeldpauschale abgewiesen.
Am Heiligen Abend wurde bekannt, dass es vier Christbäume für die vier Messen an Bord gab. Drei waren für den Salon sowie für die Offiziersmesse und die Unteroffiziersmesse bestimmt. Der ursprünglich für die Mannschaftsmesse bestimmte Baum wurde jedoch auf Anordnung des Kapitäns im vorderen Mast befestigt, da er dort ja von jedem gesehen werden konnte. Obwohl sich kaum einer etwas aus Weihnachten machte oder es sich jedenfalls nicht anmerken ließ, waren alle normalen Mannschaftsmitglieder stinksauer.
Da sich in der Unteroffiziersmesse kaum jemand aufhielt, wurde dieser Baum nach einigen Debatten dann doch noch bei den Mannschaften aufgestellt.
Zur Krönung des Festes gab es für die Mannschaft vom Koch falschen Hasen, überwiegend aus den Bratenresten vom Vortag und altem Brot.
Es war aber kein Geheimnis, dass für Kapitän und Offiziere die besten Delikatessen mit den dazu gehörenden Getränken aufgefahren wurden, so dass von mehreren Besatzungsmitgliedern massive Vorwürfe und Drohungen gegen den Koch ausgestoßen wurden, der vermutlich aber nichts für diese Sparmassnahmen konnte, denn alles, was der Mannschaft serviert wurde, konnte der Kapitän später nicht verkaufen.
Gegen zwanzig Uhr ging es wie ein Lauffeuer durchs Schiff: „Der Koch hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, wurde aber noch rechtzeitig gefunden.“ Ob die Vorgänge am Tage oder andere Gründe dafür verantwortlich waren, wurde nie geklärt und hat eigentlich auch niemanden interessiert. Blut verschmiert wie er war brachte man den Koch in einen vorhandenen Lazarettraum, wo er von zwei Matrosen rund um die Uhr bewacht wurde.
Der Ärger über die Scherereien und die Verschmutzung war bei der Besatzung stärker, als das Mitgefühl. Die meisten waren über die Tat und die dadurch entstandene zusätzliche Arbeit stinksauer, der Kapitän, dass so etwas auf seinem Schiff passierte, der zweite Offizier über den Schreibkram, der Bäcker und Schlachter darüber, dass sie jetzt allein für das gesamte Essen verantwortlich waren, die Schiffsjungen, dass sie das Blut in Kammer und Gang aufwischen mussten und die Matrosen über die Bewachung des Kochs.
In Curacao holte ein Krankenwagen den Koch ab, der aber auf eigenen Füßen mit verbundenen Armen von Bord ging, um mit einem anderen Schiff der Reederei die Heimfahrt nach Hamburg anzutreten.
Er hat den Vorfall jedenfalls ohne bleibende Schäden gut überlebt, denn ca. zwanzig Jahre später traf ich ihn zufällig als Kneipenwirt in Hamburg-Barmbek bei bester Gesundheit wieder.
Die Geschichte war wie üblich schnell verarbeitet, denn es stand die Routine der weiteren Reise und Rückfahrt nach Hamburg an.
In Hamburg musterte ich am 22. Januar 1957 ab und trat per Bahn und Bus die Heimreise in mein Heimatdorf an. Am Hauptbahnhof bestieg ich den Zug Richtung Frankfurt. Mein Gepäck bestand aus einem Seesack, einem ausgestopften, ungefähr einen Meter langen Alligator sowie einer fünfzig Kilogramm schweren Staude grüner Bananen. Das größte Aufsehen erregte die Bananenstaude, da die meisten Fahrgäste so eine Frucht in diesem Zustand noch nie gesehen hatten, und wenn, waren diese Früchte ja gelb.
Читать дальше