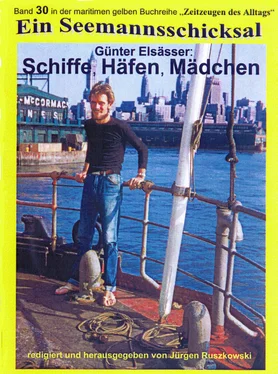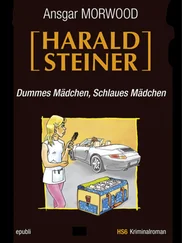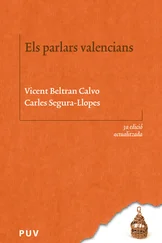Nachdem der Panamakanal Richtung Europa verlassen war, ging das große Reinmachen und Polieren in der Maschine los, denn bei der Ankunft in Hamburg musste jedes Teil der Maschine frisch lackiert oder metallisch blank sein. So wurden dann alle fünf Wochen die lackierten Flächen mit grüner Seife oder noch schärferen Mitteln gewaschen und dann neu lackiert, womit Maschinenjunge, Reiniger und auch Schmierer beschäftigt waren. Die Ing.-Assistenten konnten auf ihren Wachen nicht mehr lesen und basteln, sondern mussten auch zu Poliermitteln, Schmirgelpapier und weißen Putzlappen greifen, damit der Maschinenraum fast so sauber und glänzend wie ein Operationssaal aussah. Ein Mann war ständig dabei, die Treppengeländer im Maschinenraum, die aus normalem Stahlrohr bestanden und deshalb bei jeder Berührung anliefen, mit feinem Schmirgelpapier, Metallwolle und Politur auf Hochglanz zu bringen. Für den Glanz der Rohre und Muttern der Zylinderköpfe war ein weiterer Mann die gesamte Rückreise zuständig.
Als die Elbmündung erreicht war, durfte der Maschinenraum nur noch mit einem weißen Putzlappen in der Hand betreten werden, und ein eventuell vorhandener Ölfleck oder sonstige Verschmutzungen mussten sofort entfernt werden.
Nach dem Passieren des Feuerschiffs „ELBE 1“ wurde das Wachpersonal in der Maschine für die bevorstehende Revierfahrt mehr als verdoppelt: Ein Ingenieur als Oberaufsicht, ein weiterer am Bedienstand der Hauptmaschine, je ein Assistent für den Maschinentelegrafen, das Manöverbuch und die Hilfsdiesel, sowie ein bis zwei Schmierer für allgemeine Arbeiten traten sich fast gegenseitig auf die Füße.
Es konnte also kaum etwas schief gehen, und wir erreichten den Liegeplatz im Hamburger Hafen, wo sofort nach dem Festmachen das Löschen unserer Ladung begann.
Die Bananenstauden wurden einzeln auf Förderbänder gelegt und gelangten so aus dem Schiffsbauch in den Fruchtschuppen.
An Bord kam einige Hektik auf, da, wie bei jeder Reise üblich, ein Teil der Besatzung wechselte und alle, die keinen Dienst hatten, sofort an Land wollten.
Jedes Besatzungsmitglied hatte das Recht auf eine Staude Bananen, die vor dem ersten Landgang ausgegeben wurde. Ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, schulterte die knapp vierzig Kilo wiegende grüne Staude trotzdem und verließ das Schiff Richtung Taxistand.
Die vor dem Schiff wartenden Taxifahrer boten mir an, drei DM für die Bananen zu bezahlen und außerdem die Fahrt zum Hauptbahnhof oder St. Pauli kostenlos durchzuführen. Ich dachte, dass dieser Handel für mich ein gutes Geschäft sei, denn ich wollte erstens schnell in die Stadt und zweitens die Bananen loswerden.
Am Taxistand warteten noch einige andere Experten, die sich anboten, die doch sehr naiven Seeleute für ein kleines Honorar in angeblich besonders günstige Kleider- oder Elektrogeschäfte zu begleiten.
Die dann besuchten Geschäfte waren jedoch viel teurer als andere und bezahlten dicke Provisionen an die Schlepper.
Viele der jüngeren Kollegen machten von diesen Angeboten Gebrauch, da sie die Preise kaum interessierten und sie auch in Geschäften an Land kaum geübt und unsicher waren. So wurden Anzüge, Hemden, Krawatten und Sonstiges erworben, so gut wie nie benutzt oder im nächsten Hafen schon wieder verkauft. Zu den Fehlkäufen gehörten auch Radios, die an Bord nicht funktionierten, da nur Gleichstrom vorhanden war. In Südamerika waren sie jedoch gesucht und gut zu verkaufen.
Auch einige „Damen“ warteten auf ihre ehemaligen Verlobten, die ihnen beim letzten Bordbesuch einen dicken Ziehschein versprochen hatten, welcher jedoch nicht eingetroffen war. Der Ziehschein war die Überweisung eines Teils der Heuer an die Familien oder andere Berechtigte.
Besuche von Frauen an Bord waren ledigen Seeleuten offiziell nur erlaubt, wenn sie mit ihnen verlobt waren, auch so eine Vorschrift, die leicht zu umgehen war und an die sich sowieso keiner hielt. In den meisten Fällen schaute der wachhabende Matrose einfach in eine andere Richtung, wenn Besuch in Begleitung eines Besatzungsmitglieds aus dem Taxi stieg und die Gangway hoch kletterte. Solange es keinen Ärger gab, waren die Frauen an Bord geduldet und saßen bei den Mahlzeiten mit am Tisch, es kam mitunter sogar vor, dass sie sich in Messe und Kammer nützlich machten. Meistens wurde das Mädchen beim ersten Besuch an Bord als Verlobte vorgestellt und beim Funker ein Ziehschein mit dem Namen und der Bankverbindung beantragt. Somit war alles bis zum Auslaufen des Schiffes klar, dann wurde die Verlobung als gelöst bezeichnet und der Ziehschein per Funk bei der Reederei storniert. Bei den so um ihren Lohn geprellten Bräuten löste das natürlich keine Begeisterung aus, was bei der nächsten Ankunft des Schiffes teilweise zu lautstarken Debatten führte.
Lief das Schiff nach einer knappen Woche wieder aus, konnte nach zwei bis drei Tagen auf See der zweite Offizier, der auch für die medizinische Versorgung zuständig war, feststellen, wie ernsthaft die Verbindung zwischen Seemann und Mädchen war, denn die ersten Penicillinspritzen gegen den Tripper wurden heimlich bei ihm abgeholt. Spätestens nach zwei Wachen wusste aber die ganze Besatzung, wer sich etwas eingefangen hatte und die nächsten Tage mit Spott und Schadenfreude leben musste. Einige Tage später war dieses Missgeschick schon wieder vergessen und kein Thema mehr an Bord.
Nachdem ich die erste Reise gut überstanden hatte, bot mir der Chief an, ich könne eine freiwerdende Stelle als Reiniger übernehmen, worüber ich natürlich begeistert war und nicht mehr an eine Abmusterung dachte. Die Heuer war für diesen Job ungefähr viermal höher, die Arbeit im Maschinenraum interessanter und entsprach mehr meinen Kenntnissen und Vorlieben.
Da die Fahrtroute fast immer gleich der ersten war, interessierte es kaum noch jemand, wie die Umgebung des Schiffes auf dem Ozean aussah, höchsten bei in Sicht kommenden außergewöhnlichen Schiffen, Walen oder größeren Delphinherden wurde die Arbeit oder Freizeit unterbrochen und ein Blick gewagt.
Nach dem Auslaufen wurde uns mitgeteilt, dass wir uns besonders ruhig und ordentlich zu verhalten hätten. Der Reeder sei mit Frau an Bord, und wir würden Las Palmas auf Gran Canaria anlaufen, damit der Reeder dort Urlaub machen könne. An eine Flugverbindung von Deutschland zu dieser Insel hat zu jener Zeit noch niemand gedacht.
Ein Hafen im üblichen Sinne existierte in Las Palmas nicht, es gab lediglich eine lange Mole, im Hintergrund weiße Häuser, umgeben von braunen, kahlen Bergen. Dicht an der Stadt war die Landschaft verbaut mit großen Tanks für Schweröl und Diesel, von denen dicke Rohre bis an das Ende der Mole führten.
Keiner an Bord wäre zu dieser Zeit bereit gewesen, freiwillig Urlaub auf der Insel zu machen, deshalb wurde das Vorhaben des Reeders als ziemlich verrückt angesehen.
Las Palmas wurde praktisch nur von Schiffen auf dem Weg nach Südamerika oder zur Westküste Afrikas angelaufen. Die Schiffe benutzten die Zollfreiheit der Insel zum Bunkern von Öl und Wasser. Einen größeren Flugplatz gab es nicht, und das Wort Tourismus hatte auch noch keiner gehört.
Da das Anlegen hätte bezahlt werden müssen und wir üblicher Weise auf Curacao unsere Vorräte ergänzten, wurde ein Rettungsboot zu Wasser gelassen und die Reederfamilie samt Gepäck an Land gebracht.
Zum Abschied mussten alle, die keinen Dienst hatten, in sauberer Kleidung und mit Schwimmwesten an Deck erscheinen. Dieses Ausbooten des Reeders wurde im Schiffstagebuch als Bootsmanöver vermerkt, es war das einzige, an welchem ich während meiner ganzen Fahrtzeit teilgenommen habe.
Ein anderes Schiff der Reederei hat dann die Familie einige Wochen später wieder für ihre Rückreise nach Hamburg abgeholt.
Nach der Weiterfahrt kurz vor Sonnenuntergang entstand wieder einige Aufregung an Deck: Über den Wolken tauchte bei sommerlichen Temperaturen der schneebedeckte Gipfel des Tede auf Teneriffa auf, ein Berg, von dem die meisten noch nie etwas gehört und den kaum einer von der Besatzung zuvor gesehen hatte.
Читать дальше