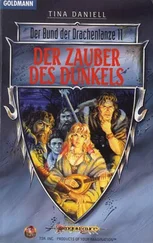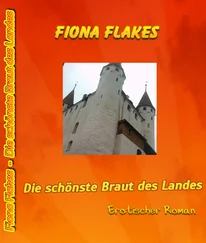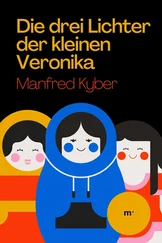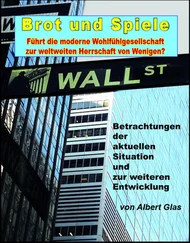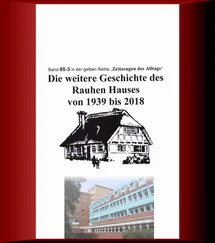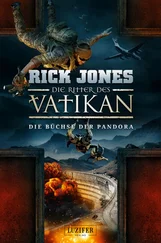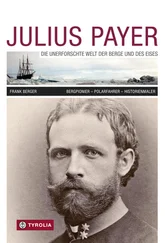Wir gehen ferner davon aus, dass ein technisches Konzept, das in Anspruch nimmt, auf existierenden technologischen Plattformen realisiert werden zu können, sich entweder innerhalb von zehn Jahren flächendeckend durchsetzt, oder auf Dauer Nischencharakter behält. (Wir verweisen auf die Geschichte der Expertensysteme.)
Beide Annahmen sind nicht trennscharf genug, um Voraussagen über technische Details zu machen: Ob Userinterfaces des Jahres 2025 überwiegend auf Touchscreens abgestimmt sind, ob u.U. sogar die Tastatur als konfigurierbarer Teil eines Touchscreens realisiert wird und dadurch die Rahmenbedingungen für das Design von Interfaces radikal verändert werden, ist nicht vorhersagbar.
Allerdings halten wir dies für weniger relevant, als die uns eindeutig erscheinende Vorhersage, dass etwa die Texteingabe weiterhin wesentlich tastaturbestimmt sein wird und weder von der Stimmeingabe, noch von handschriftlicher Styluseingabe abgelöst werden wird. Beide letztere Varianten sind seit zehn Jahren prinzipiell verwendbar, zeigen nach dem zweiten oben angegebenen Kriterium jedoch keine Tendenzen, die bestehenden Eingabeformen flächendeckend zu verdrängen.
Die genannten Annahmen scheinen uns manche Szenarien, die in der Tat das Potential hätten, die Informationsversorgung wirklich radikal neu zu gestalten, auszuschließen. Derartige Szenarien, die wir explizit nicht berücksichtigen, sind insbesondere die folgenden:
Direct mind interfaces, also Interfaces, die die Steuerung von Rechnern durch Gedanken zulassen, sind noch in einem so frühen Stadium der Entwicklung, dass wir sie für die nächsten fünfzehn Jahre ignorieren.
3D Technologien werden in den nächsten fünfzehn Jahren eine erhebliche, um Größenordnungen wichtigere Rolle spielen. Wir sehen sie jedoch als eine einfache lineare Fortschreibung des Trends zu einer größeren Wichtigkeit nichttextueller Medien. Wir sehen weder GUIs, die echte inhaltliche Fortschritte der Informationsdarstellung auf der relativ beschränkten Oberfläche von 2D Medien erlauben würden, noch echte 3D Interfaces, durch die räumliche, etwa holographische Projektion raumfüllender Interfaces, als derzeit berücksichtigenswerte Trends an.
Sehr signifikante Wandlungen in den langfristig aufzubauenden Strukturen zur Informationsversorgung könnten von genuin langlebigen Speichermedien mit hoher Kapazität ausgehen (Dies bedeutet: mindestens 100 Jahre garantierter Haltbarkeit, bei mindestens 10 TB Kapazität zum Kaufkraftäquivalent des Preises einer derzeitigen CD-ROM / DVD-ROM professioneller Qualität.) Eine derartige Technologie würde einen erheblichen Einfluss auf die zur langfristigen Informationsversorgung notwendigen technischen Strukturen ausüben und Teile der im Folgenden beschriebenen Trends konterkarieren. Wir stellen jedoch nicht nur fest, dass bisher alle Versuche in diese Richtung weisende Speichermedien, vornehmlich holographisch orientiert, fehlgeschlagen sind, sondern zudem alle Medien, die in die Nähe der Marktreife kamen, so konzipiert waren, dass noch einige Jahre mit zunehmend höheren Informationsdichten gearbeitet werden sollte, was dem Gedanken eines langfristig gleichbleibend verfügbaren Mediums eben gerade nicht entspricht.
Unter Ausschluss der genannten Szenarien halten wir die folgenden technischen Trends für die nächsten fünfzehn Jahre für prägend.
2.1.1. Trend I: Technologische Konvergenz
Auf den ersten Blick scheinen die Entwicklungen der letzten fünf Jahre eher eine Tendenz zur Diversifizierung anzudeuten.
Im Jahre 2005 gab es de facto nur zwei Betriebssysteme: Eines, das keine klare Trennung zwischen Systemkern und Userinterface hat (Windows) und eines, das diese klare Trennung aufwies (Unix) – auch wenn in einem Fall die Unterschiede in der Ausgestaltung des Interfaces (Apple seit Mac OS X) so gravierend sind, dass es als drittes Betriebssystem wahrgenommen wird. In den letzten Jahren entstanden aus der Notwendigkeit verschiedene mobile Devices zu unterstützen wieder deutlich voneinander abweichende Betriebssysteme.
Im Jahre 2005 gab es de facto nur mehr eine Grundform des Endgerätes: Verschiedene Laptops, Desktops oder Laptops und Desktops als Frontends für Rechnerkonfigurationen höherer und hoher Leistung stellten eine einheitliche Metapher des Zugangs zu Rechnerressourcen bereit. Auch hier haben die mobilen Devices erstmals wieder eine deutliche Diversifizierung eingeleitet.
Im Jahre 2005 schien schließlich, völlig unabhängig von den mobilen Devices, die Entwicklung praxisrelevanter Programmiersprachen abgeschlossen – unter anderem dadurch, dass die zunehmende Rechenleistung den Performanz-Nachteil von Scriptsprachen verwischte. Seitdem zeichnet sich wieder eine stärkere Diversifizierung der Sprachen ab.
Diese Diversifizierung einzelner Aspekte der technologischen Landschaft steht der Herausbildung einer voll integrierten konvergenten Informationslandschaft jedoch keineswegs im Wege. Dies wird dadurch erzwungen, dass zum Unterschied etwa zum Jahre 1995 mittlerweile zahlreiche Dienste existieren, die als genuin und zentral alltagsrelevant gelten und deren nicht-Erreichbarkeit – etwa auf einer neuen Endgeräteklasse – deren Erfolg in Frage stellt.
Dieses Prinzip sei an einem fiktiven Beispiel näher beschrieben:
Es ist klar, dass im Jahre 2025 erwartet werden wird, dass auch während Flugreisen ständiger Kontakt zu den gewohnten Informationsdienstleistungen gewährleistest ist. Im Folgenden sei aufgezeigt, dass diese Erwartung – die Erwartung nach der ständigen Verfügbarkeit informationstechnischer Leistungen, unabhängig von der dafür eingesetzten Technologie – innerhalb von mindestens drei Szenarien möglich ist, die derzeit bestehende technische Trends in unterschiedlicher Weise fortschreiben.
Beobachtend, dass Desktops, Laptops und mobile Geräte sich durch die intermediäre Klasse von Tablets zuletzt wieder ein wenig annähern, besteht ein radikales Szenario in der Annahme, dass die Entwicklung biegsamer Displays in den nächsten fünfzehn Jahren solche Fortschritte macht, dass sie sich zu falt- und ggf. auch knautschbaren flachen Objekten weiter entwickeln. Ein derartiges Gerät könnte mit einem handgroßen Prozessor verbunden werden und auf einem Teil ihrer Oberfläche via Touchscreen eine Tastatur emulieren. Auch könnte es übergangslos zwischen Wohnung und Büro auch in den dazwischen benutzten Verkehrsmitteln verwendet werden.
Beobachtend, dass informationstechnische Komponenten und mobile Endgeräte insgesamt radikal billiger werden, besteht ein anderes radikales Szenario in der Annahme, dass die Umwelt in den nächsten Jahren immer stärker mit auf den lokalen Einsatzort optimierten Benutzeroberflächen durchsetzt wird. Diese Benutzeroberflächen könnten jeweils mit der persönlichen Datenhaltung auf einem anderswo lokalisierten Rechner verbunden werden. Gehen wir von einer heimischen Medienkonsole, einem heutigen Endgeräten noch recht nahen Büroarbeitsplatz und einem als Touchscreen ausgestalteten ausklappbaren Esstischchen im Flugzeug aus, haben wir die gleiche übergangslose Nutzung von Informationsdiensten zwischen Wohnung und Büro, sowie den dazwischen liegenden Verkehrsmitteln, wie in Szenario 1 vor uns. Diese Nutzung findet aber auf der Basis einer im Detail völlig anderen technischen Entwicklung statt.
Beide bisher genannten Szenarien sind Extreme: Zahllose Zwischenformen existieren. Verwiesen sei etwa auf die Möglichkeit, die Datenhaltung gerätetechnisch noch wesentlich stärker von deren Verarbeitung zu trennen wie heute, sodass etwa ein USB-Nachfolge-Speichergerät mit unterschiedlichen informationsverarbeitenden Geräten zu Hause, im Verkehrsmittel und im Büro verbunden werden könnte.
Allen genannten Szenarien ist allerdings gemeinsam, dass sie eine Interoperabilität von Informationsdiensten und -objekten voraussetzen, die wesentlich über der heutigen liegt. Hierin, nicht in der Frage, wie ein bestimmtes Kommunikationsprotokoll bedient werden kann, liegt die große Herausforderung für die weitere Entwicklung der Informationsversorgung im Allgemeinen und der der Hochschulen im Besonderen.
Читать дальше