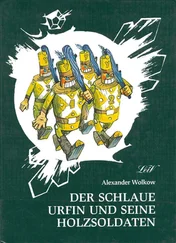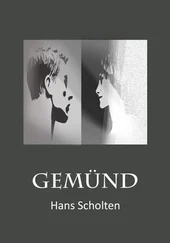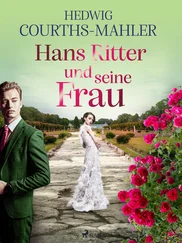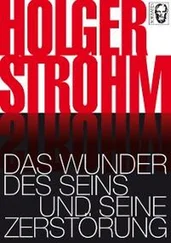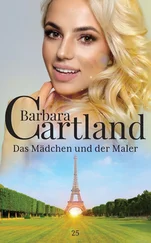Hier wurde um 1470/80 Matthias Grünewald geboren; er starb 1528 in Halle an der Saale. Er war einer der bedeutendsten Maler seiner Zeit. Wie kaum ein anderer beherrschte er die Probleme der Gestaltung der Raumtiefe und die porträthafte Herausarbeitung der Physiognomie. Sein berühmtestes Werk ist der Isenheimer Altar, gemalt für die Klosterkirche der Antoniter in Isenheim im Elsass. Heute befindet sich dieses Werk im Museum Unterlinden in Colmar.
Nürnberg
Albrecht Dürer. Er ist hier erwähnt, weil er der bekannteste Maler jener Zeit war. Aber er war ein RenaissanceMaler, kein gotischer Maler. Er führte die Malerei in eine neue Zeit.
Köln
In Köln war Anfang des 15. Jahrhunderts Stephan Lochner der bedeutendste Maler. Er wurde wahrscheinlich um 1400 in Meersburg am Bodensee geboren und starb 1451 in Köln. Sein Stil kennzeichnet sich durch eine märchenhafte Feierlichkeit, leuchtende Farben und Darstellung des seelischen Ausdrucks. Führender Maler wurde in Köln Anfang des 16. Jahrhunderts Barthel Bruyn der Ältere, geboren in Wesel 1493, in Köln gestorben 1555.
Wesel
Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen, an der Mündung der Lippe in den Rhein gelegen. Dom St. Willibrord, gegründet 8. Jahrhundert, im 2. Weltkrieg weitestgehend zerstört, im Stil des 15. Jahrhunderts wieder aufgebaut. Ebenfalls wieder aufgebaut wurde die gotisch-flämische Rathausfassade von 1455 auf dem Großen Markt. Zitadellentor und Berliner Tor der ehemaligen preußischen Befestigungsanlagen (17./18. Jahrhundert).
Die Stadt ist Geburtsort von vieren der wichtigsten Maler der späten Gotik: Derick Baegert, Jan Baegert, Jan Joest und Barthel Bruyn d. Ä.
Derick Baegert wurde 1439 in Wesel geboren und ist nach 1509 gestorben. Er gilt heute, nach seiner Entdeckung Anfang des 20. Jahrhunderts und umfangreicher Forschung, als einer der bedeutendsten Maler der späten Gotik. Lange Zeit tauchte sein Name in der kunstgeschichtlichen Diskussion kaum auf. Insoweit teilte er das Schicksal mit Robert Campin, dem „Meister von Flémalle“. Nicht einmal das berühmte Gemälde „Die Eidesleistung“, das er 1493 für das in Wesel neu errichtete Rathaus malte, wurde ihm zugeschrieben. Seine heute noch erhaltenen etwa 40 Hochaltargemälde und sonstigen Bildtafeln wurden wohl in der Bilderstürmerzeit verkauft. Sie fanden eine Heimat in anderen Kirchen oder in Privatbesitz, ohne dass der Name ihres Schöpfers weitergegeben wurde. Nach eingehender Diskussion in der Fachwelt benannte 1932 Franz Witte, der Direktor des Kölner Schnütgen-Museums, in einem Aufsatz „Revolutionäres zur Rheinisch-Westfälischen Kunstgeschichte“ Derick Baegert als den Schöpfer dieser Bilder. Witte fand bis heute keinen Widerspruch. Seitdem ergab sich die Möglichkeit, die Bilder in Zusammenhang zu sehen und zu vergleichen und sich ein Urteil über den Maler zu bilden. Es ergab sich das Bild eines überragenden Künstlers, dessen hervorstechende Eigenschaft die geradezu spielerische Leichtigkeit war, mit der er Gesichtsausdrücke der Menschen unterschiedlichster Art und unterschiedlichen Charakters, in den unterschiedlichsten Stimmungslagen, nahezu naturalistisch zeichnete und malte, und zwar in beliebig großer Zahl. Diese Meisterschaft zeigte sich besonders eindrucksvoll auf den Retabeln mit dem Thema „Volkreicher Kalvarienberg“, die erhalten sind. Eines steht in der Dortmunder Dominikanerkirche, dort wo es 1476 aufgestellt wurde, das zweite hat Derick Baegert für die Mathenakirche in Wesel hergestellt. Es wurde später zersägt und verkauft. Die einzelnen Stücke fand man jedoch wieder. Sie befinden sich heute vor allem in Museen in Madrid und Münster.
Derick Baegert gründete gleich eine ganze Dynastie von Malern, die heute zu den bedeutendsten jener Zeit zählen. Sein Sohn Jan Baegert fertigte für mehrere Kirchen in Westfalen Hochaltargemälde im Stile seines Vaters. Sein Neffe Jan Joest schuf die 20 Bildtafeln im Hochaltar der Nicolaikirche in Kalkar. Sie werden heute zu den großartigsten gezählt, die jene Zeit hervorgebracht hat.
Der Volkreiche Kalvarienberg, die Kunst des Malens von Retabelgemälden und die Baegert-Sippe
Im späten Mittelalter begann man, hinter dem Altar das Leiden Christi abzubilden; die Gläubigen sollten eine Verbildlichung davon zu sehen bekommen. In Italien, wo diese Entwicklung ihren Anfang genommen hatte, wurden zunächst die Wände hinter dem Altar mit der Leidensgeschichte Christi bemalt. Nördlich der Alpen, wo die Gotik Einzug gehalten hatte, die für die Wände der Kirchen Fenster vorsah und damit kaum Platz für Bilder ließ, stellte man auf die Rückseite des Altartisches ein Gemälde, das die Geschehnisse auf Golgatha abbildete. Zunächst auf einem einzigen Tafelbild, später auf einem Altarbild, das mit Flügeln versehen war. Auch die Flügel wurden innen wie außen mit Bildern des Leidensgeschehens bemalt. Man nannte es Retabel, Rücktisch, Rückseite des Altartisches.
Die Baegert-Sippe war fleißige Herstellerin solcher Retabel. Ihr Thema war der später sogenannte „Volkreiche Kalvarienberg“, eine Hinrichtungsszene Christi am Kreuz, dieser deutlich erhöht in der Mitte, rechts und links die Schächer. Darunter stehen Offizielle, die sich für wichtig genug hielten, dabei sein zu müssen; an ihren kostbaren Gewändern erkennbar. Um sie herum Soldaten, teils zu Pferde, die das Geschehen vor dem einfachen Volk schützen, das neugierig zuschaut. Zwischen ihnen Maria, die zusammenbrechende Gottesmutter, Maria Magdalena und Johannes der Evangelist, aber auch Veronika, die das Schweißtuch hochhält, von klagenden Frauen umgeben. Ganz am unteren Rand prügeln sich die Henkersknechte um das Gewand Christi, liegen Trinker am Boden, die Flasche im Mund.
Diese Art Altarbilder dienen uns heute der Zuordnung von Bildern der damaligen Zeit: zu Orten der Entstehung und zu den jeweiligen Künstlern.
Weiter zur Klärung wichtiger Fragen, zum Beispiel, wie es dazu kommen konnte, dass 1452 im westfälischen Schöppingen ein Altargemälde mit dem Thema „Volkreicher Kalvarienberg“ aufgestellt werden konnte, dessen Schöpfer aus dem burgundischen Kulturkreis stammen musste, aber keiner weiß, an welchem Ort er gewirkt haben könnte. Des Weiteren, wie im nicht gerade wegen seiner Künstler berühmten Wesel, ein Maler 1464 seine Werkstatt eröffnen konnte, der „Volkreiche Kalvarienberge“ von höchster Qualität malte, aber keiner sich erklären konnte, wo er es gelernt hatte.
Wohl das erste Bild mit dem Thema „Volkreicher Kalvarienberg“ stammt von den Brüdern Hubert und Jan van Eyck. Es wurde zwischen 1430 und 1440 gemalt. Als Fundort wird in der Literatur „Turiner Stundenbuch“ angegeben. Alle späteren Werke zu diesem Thema folgen seinem Beispiel.
Der Schöppinger Altar wird mehr als zehn Jahre später aufgestellt. Er ist von nicht geringerer Qualität, kann aber nicht von den Brüdern van Eyck stammen; 1441 ist Jan van Eyck als letzter der Brüder van Eyck gestorben.
Wir geraten wie zwangsläufig auf die Spur von Malerwerkstätten in Utrecht. Die Stadt war bedeutender Bischofssitz und besaß eine der mächtigsten gotischen Kathedralen. Sie war das Kulturzentrum Hollands schlechthin. Schon die Historikerinnen Dr. Elisabeth Baxheinrich-Hartmann und Dr. Petra Marx 9 vermuteten solche Werkstätten in Utrecht, die ein Meisterwerk wie den Schöppinger Altar hätten hervorbringen und einen Derick Baegert aus- oder weiterbilden können.
Die Frage, wie das Vorbild „Volkreicher Kalvarienberg“ nach Utrecht gekommen ist, lässt sich dadurch beantworten, dass ein malerisches Leistungszentrum fast immer in engem Kontakt mit anderen Zentren stand. Man hatte eine ziemlich einheitliche Informationsebene.
Читать дальше