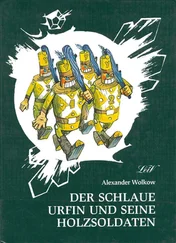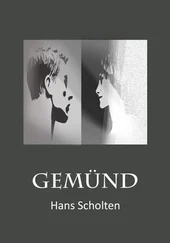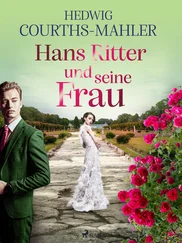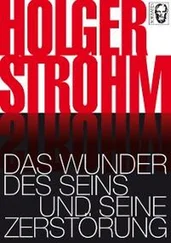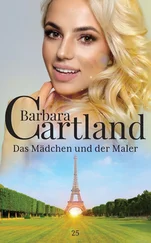Wie in vielen seiner Werke verbindet Hans Scholten auch in dieser Lektüre historische Fakten rund um die Hauptcharaktere mit möglichen Erlebnissen aus deren Leben, die rein fiktiv sind, aber durchaus so geschehen sein könnten. So halten wir ein Buch in Händen, welches sich unterhaltsam lesen lässt und dennoch die wichtigsten historischen Eckpunkte seiner Zeit korrekt darstellt. Der Lesende taucht ein, in die alte Hansestadt Wesel zu ihrer Hochzeit und in die Fertigkeit der hohen Kunst der Malerei von Altargemälden mit „viel zuschauendem Volk“, einer, zu der Zeit neuartigen, realistischen Darstellung von Menschen und deren Charakterzügen. Auch die Art des Reisens im Mittelalter, die Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens in mittelalterlichen Städten sowie deren Freuden werden kunstvoll in den Text verwoben. Einige, der im Buch beschriebenen Retabel, sind noch heute in der Weseler Umgebung zu bestaunen. Dazu finden Sie Links und weitere Hinweise am Ende dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken!
Herausgeberin:
Ruth Schäfer M.A., Literatur- und Sprachwissenschaftlerin der Anglistik und Germanistik, Lektorin und literarische Beraterin Dr. Scholtens.
Beraterin:
Dagmar Ewert-Kruse, langjährige gute Freundin und Mitstreiterin des Autors.
Cover und Gestaltung:
Gudrun Bröckerhoff, kreative Gestalterin der Buchcover für Dr. Scholtens Bücher seit 2017.
Im 15. Jahrhundert brechen die Zeiten um. Der Humanismus löst das Zeitalter der Scholastik ab, die Renaissance tritt an die Stelle der Gotik. Religionsstifter treten auf den Plan, sie wollen das Christentum verändern. Im 16. Jahrhundert haben sie Erfolg. Sie spalten die Kirche, weil die Kirche sich nicht ändern will. In dieser Schlussphase einer Epoche entsteht im Norden des Heiligen Römischen Reiches und im niederländischen Burgund eine Malkunst von großer Schönheit und Kunstfertigkeit.
Im burgundischen Flandern liegen die Kunstzentren Tournai, Brügge, Gent und Brüssel. Dort geben die Maler Robert Campin, Hubert und Jan van Eyck sowie Rogier van der Weyden den Ton an.
Am Niederrhein und im Norden der heutigen Niederlande sind Wesel und Utrecht die Kunstzentren. In Wesel wirkt der Maler Derick Baegert. Die Wissenschaft hat die Geschichte der flandrischen Maler vielfach aufgearbeitet. Allerdings blieben die Hintergründe der Malerei im Norden der Niederlande und des Niederrheins dabei weitestgehend im Dunkeln. Erst Historiker des 20. Jahrhunderts widmeten sich intensiver diesen Regionen und ihren Malern. Vieles wurde erforscht, Maler und Gemälde aufgespürt. Vieles blieb unentdeckt. Was herausgefunden wurde, stellt eine großartige Künstlerlandschaft mit herausragenden Gemälden und Malern dar. Nicht immer gelang es, alle Gemälden ihren Malern zuzuordnen. Viele Rätsel blieben.
Dieses Buch unternimmt den Versuch, den Stand des Wissens darzustellen und ungelöste Rätsel der Lösung näher zu bringen. In einem zweiten Schritt möchte der Autor das Leben jener Zeit und Kunstwelt schildern. Dieses Buch soll keine trockene Schrift über ein Zeitalter werden, sondern etwas, das den Leser an Wissen bereichert und unterhält, das man gerne am Kamin liest.
Derick Baegert hing seinen Gedanken nach. Er saß vorne auf einem Händlerkarren, dieser würde bald Geldern erreichen. Er musste an seinen Vater denken. Der hatte ihn nicht gerne ziehen lassen.
„Und du möchtest nach Flandern, weil es dort die größten Maler gibt?“, hatte er gefragt.
„Ja. In Flandern gibt es die besten Malerwerkstätten. Sie arbeiten in der Tradition Robert Campins in Tournai und der Brüder van Eyck in Gent und Brügge. Ein großer, der auch bei Robert Campin gearbeitet hat, ist Rogier von der Weyden, er lebt noch. In Brüssel. Ihn möchte ich kennenlernen, vielleicht bei ihm arbeiten.“
Sein Vater hatte ihn ziehen lassen, ihm auch Geld für die Reisekosten gegeben, nicht ohne zu bemerken: „Am besten, du reist mit den Fuhrleuten und bietest deine Hilfe an. Dann kostet es weniger.“
So hatte Derick in den nächsten Tagen über den Rhein gesetzt. Schon auf der Fähre hatte er einen Händler angesprochen, der Waren aller Art auf der Reise in Richtung Geldern verkaufen wollte. Ja, er werde ihn gerne ohne Bezahlung mitnehmen, wenn er helfe, Waren vom Fuhrwerk zu den Kunden zu tragen.
In Geldern angekommen, fand Derick alsbald einen Händler, der ihn weiter mitnahm. Am vierten Tage war er in Venlo, nach weiteren drei Tagen in Eindhoven und weiteren sechs Tagen in Antwerpen.
So beginnt der Roman. Wenn der Leser ihn nun weiterläse, würden ihm einige Hintergründe zum rechten Verständnis fehlen. Der Roman schildert ein Geschehen um das Jahr 1500. Vieles über die Akteure und ihr Handeln ist bekannt, vieles nicht.
Um den Leser in die damalige Zeit und ihre großartige Kunst einzuführen und um Bekanntes und Erdachtes zu trennen, hat der Autor Bekanntes jedem Kapitel in Kursivschrift voran gesetzt. Er ist auch selbst vielen ungelösten Fragen nachgegangen und glaubt, vieles einer Lösung näher gebracht zu haben. Auch dieses findet der Leser in kursiv geschriebenen Teilen innerhalb des Romans.
Das Phänomen Derick Baegert und seine Sippe
Zur Klärung des Phänomens Derick Baegert - einem großen Maler, der plötzlich auf der Bühne der Zeitgeschichte erscheint, weitab von den großen Kunstzentren der Zeit, Köln und Flandern - hat in neuerer Zeit der Stadtarchivar von Wesel, Dr. Martin Roelen 5 , einen wesentlichen Beitrag geleistet. Er ist in den Archiven der Stadt fündig geworden.
Dort fand er den Namen Derick Baegert in den Resten des Stadtarchivs, die dem Bombenkrieg des Zweiten Weltkrieges nicht zum Opfer gefallen waren. Auch auf die Namen Jan Baegert, Jan Joest und Barthel Bruyn stieß er dort. Sie wurden als Bürger der Stadt Wesel geboren und waren Derick Baegerts Schüler. Ebenso konnte Roelen die Verwandtschaftsbeziehungen klären. Dass Jan Baegert, Schöpfer vieler bedeutender Hochaltargemälde in Westfalen, wie in Cappenberg, Herzebrock und Liesborn, ein Sohn Derick Baegerts war, wurde schon vermutet; dies konnte nun bestätigt werden.
Jan Joest, Maler der zwanzig Bildtafeln im Hochaltar der Nicolaikirche in Kalkar, war ein Sohn von Derick Baegerts Schwester Katharina, sie hatte einen Heinrich Joest aus Wesel geheiratet. 6 Jan Joest ging nach Haarlem und gründete dort eine Malerwerkstatt, nachdem er aus Wesel verbannt worden war. Er hatte die Stadt verlassen müssen, weil man vermutete, er würde unter Aussatz leiden. Zuvor hatte er sich Ärzten in Köln und Haarlem vorstellen müssen. Die Kölner Ärzte äußerten sich nicht konkret. Haarlemer Ärzte, die ihn längere Zeit beobachteten um festzustellen ob die körperlichen Veränderungen, wie beim Aussatz üblich, fortschreiten würden, bestätigten dagegen, dass Jan Joest nicht an Lepra erkrankt sei. Jan Joest kam mit dieser Botschaft und einem Stadtboten der Stadt Haarlem nach Wesel zurück. Dieser bestätigte vor dem Weseler Rat das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung. Jan Joest musste dennoch die Stadt verlassen. Er kehrte mit dem Stadtboten nach Haarlem zurück. Dort gründete er eine Malerwerkstatt. Von seinen Bildern sind nur wenige erhalten. Darunter sein wichtigstes Werk: Die Bildtafeln in der Nicolaikirche in Kalkar.
Die Daten des Personenregisters der Stadt Wesel ergaben weiter, dass Jan Joests Tochter Agnes Barthel Bruyn heiratete. Der in Wesel geborene Barthel Bruyn muss also lange Beziehungen zu Jan Joest in Haarlem gehabt haben.
Barthel Bruyn lebte später in Köln, wo er eine bedeutende Malerwerkstatt gründete. Er zeugte dort einen Sohn, den er Barthel nannte. Dieser wurde ebenfalls Maler. Um Vater und Sohn unterscheiden zu können, haben Historiker dem Vater den Beinamen „der Ältere“, dem Sohn den Beinamen „der Jüngere“ gegeben.
Читать дальше