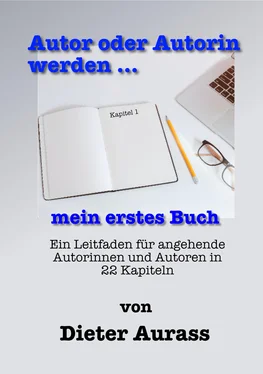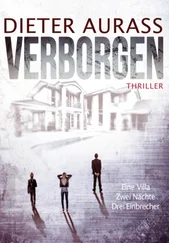Dieter Aurass - Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch
Здесь есть возможность читать онлайн «Dieter Aurass - Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Was da aber in ihrem Manuskript stand, war:
Die Aktion von der Frau Meier machte die Planung von dem Kommissar zur Nichte.
Zum besseren Verständnis: In der männlichen Version hätte dort gestanden: zum Neffen!
Was viele vielleicht überraschen wird, ist der Umstand, dass ... keines der von mir getesteten Schreibprogramme, selbst dasjenige, welches viele Profi-Autorinnen und Autoren benutzen, hat bei diesen wirklich lustigen Sätzen einen Fehler angezeigt. Ganz nach dem Motto:
Alles gut, alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen!
Weder der durch den Dativ so grauenvoll ersetzte Genitiv ( der Hund von dem Herrn Müller ) noch die sinnentstellenden Worte wurden moniert.
Wir sind also offensichtlich noch weit davon entfernt, dass Computerprogramme uns jegliche Arbeit abnehmen oder Lektorat und Korrektorat ersetzen können. In den aufgeführten Sätzen waren alle Wörter richtig geschrieben, also hatte das Programm nichts zu meckern.
Das das Geschriebene keinen wirklichen Sinn macht und grammatikalisch grauenhaft ist, interessiert kein Programm der Welt (na ja, zumindest keines das ich kenne – wer ein solches Programm kennt, möge es mir bitte nennen, ich würde es sofort kaufen!)
Was lernen wir daraus? Hilfsprogramme sind nur eines von verschiedenen Werkzeugen. Ein sicherlich noch wichtigeres Werkzeug ist ... die Sprache beziehungsweise die Fähigkeit der Autorin oder des Autors, die Sprache richtig einzusetzen.
Dazu zählt als einer der wichtigsten Faktoren ... der Wortschatz der Person, die schreiben möchte.
Der gesamte Wortschatz der deutschen Sprache wird (je nach Quelle der Angaben) mit 300.000 bis 350.000 Wörtern angegeben.
Zum Vergleich: Goethe soll über einen Wortschatz von 80.000 Wörtern verfügt haben, was wirklich schon beeindruckend ist. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass es zu Goethes Lebzeiten noch wesentlich weniger Wörter gab als heute.
Ein durchschnittlich gebildeter Sprecher der deutschen Sprache soll auf etwa 4.000 bis 10.000 Wörter zurückgreifen können. Im Alltag genügen angeblich 400 bis 800 Wörter, um sich adäquat zu verständigen.
An dieser Aussage wage ich ein wenig zu zweifeln, aber vermutlich kommt es darauf an, was man unter adäquat versteht.
Um im Urlaub auf Mallorca zu überleben und mich mit Essen und Getränken zu versorgen, reichen sie auf den Fall.
Dann unterscheidet man noch zwischen dem »aktiven« und dem »passiven« Wortschatz. Aktiv ist das, was ich in Gesprächen oder beim Schreiben, ohne nachzuschlagen, benutze – passiv ist das, was ich verstehe, wenn ich es höre.
Ihn einer Publikation habe ich gelesen, dass man einen »passiven Wortschatz« von etwa 20.000 Wörtern benötigt, um die Werke angesehener Autoren lesen und komplett verstehen zu können.
Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die über diesen Wortschatz verfügen (passiv) und nicht alle paar Seiten nachschlagen müssen, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Aber hier zeigt sich wieder, was ich schon im 3. Kapitel angesprochen habe:
Wer viel liest, wird seinen passiven Wortschatz immer mehr erweitern und so verfestigen, dass zumindest ein Teil auch in den aktiven Wortschatz wandert.
Wer hätte vor einigen Monaten noch gedacht, dass vermutlich 80 - 90% der Deutschen einmal wüssten, was ein Virologe oder ein Epidemiologe ist und was die so machen.
Ein begrenzter Wortschatz führt dann manchmal zu Ergüssen, bei welchen zwar jeder versteht, was da gerade passiert, es sich aber nicht wirklich schön anhört oder liest:
Ein kleines Beispiel gefällig?
»Erst ist er ins Kino gegangen, danach nach Hause gegangen und als er dann zum Einkaufen gegangen ist, hat ihn der Kaufmann gefragt, wie geht`s und er hat gesagt, geht so.«
Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass in dem obigen Satz nur ein einziges Mal eine Abwandlung von »gehen« vorkommt – was deutlich besser wäre.
Obwohl ... jeder hat sicherlich verstanden, worum es ging ... oh nein, besser: worum es sich drehte.
Nun aber noch zu einem anderen Werkzeug, das nicht wirklich viele Autorinnen oder Autoren einsetzen, dessen Gebrauch mich aber wirklich fasziniert hat:
Ein befreundeter Autor setzt sehr erfolgreich eine Diktat-Software ein.
Wenn jemand unter Legasthenie oder einer starken Rechtschreibschwäche leidet, oder aber mit lediglich zwei Fingern nur sehr langsam tippen kann und sich dabei noch oft vertippt ... für den wäre eine solche Software sicherlich eine große Hilfe.
Natürlich ist diese Software nicht ganz billig, aber wer das nötige Kleingeld hat, sollte, wenn er zu einer der vorgenannten Gruppen zählt, nicht an der falschen Stelle sparen.
Ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass der befreundete Autor NICHT zu diesen Gruppen zählt ... er findet es einfach bequemer, hat sich nach einer Handverletzung eingearbeitet und möchte diese Art, seine Gedanken zu Papier zu bringen, nicht mehr missen.
Wie gesagt, es gibt viele Werkzeuge und Hilfsmittel, aber keines davon ist richtig, falsch oder unverzichtbar. Lasst euch nicht einreden, dass ihr ein bestimmtes Programm braucht oder am besten diese oder jene Vorgehensweise benutzt, um euch dem Schreiben zu nähern.
Wenn mir ein Autor berichtet, die besten Ideen kämen ihm auf dem Klo und er schreibe diese dann mit einem Filzstift an eine hellgrün getünchte Wand, die er später abfotografiert und den Text von einer Schreibkraft nach dem Foto übertragen lässt ... dann kann ich nur sagen:
»Toll, wenn du damit am besten zurechtkommst, ist das für dich genau das Richtige. Weiter so!«
Für mich wäre es vermutlich eher nichts, allerdings habe ich es auch noch nie ausprobiert.
Die allerbesten Werkzeuge sind unser Verstand, unser Gedächtnis und unsere Fähigkeit, beides vernünftig einzusetzen.
Ein weiterer Leitsatz für alle Autorinnen und Autoren sollte sein:
Schreibe nicht über etwas, von dem du keine Ahnung hast, und wenn doch, dann frage zuerst jemanden, der Ahnung hat oder recherchiere sehr sorgfältig im Vorfeld des Schreibens.
Auf das Thema Recherche und recherchieren komme ich später auch noch in einem eigenen Kapitel zu sprechen.
Kapitel 5 – Idee
Von der Idee zum Buch – gibt es einen »richtigen« Weg?
Ich will versuchen, diese Frage wenigstens in einigen Bereichen hoffentlich befriedigend zu beantworten.
»Am Anfang war die Dunkelheit« ... so steht es zumindest in dem wohl berühmtesten Buch der Welt ... genau, in der Bibel. Und der Satz hätte vielleicht auch so weitergehen können: »... und dann kam mir eine Idee.«
Für Autorinnen und Autoren heißt es allerdings eher: »Am Anfang war die Idee, dann erschuf ich den Rest.«
Woher kommen die Ideen für einen Roman? Das ist so unterschiedlich wie die Autorinnen und Autoren selbst, die Eine zieht sie aus Zeitungsmeldungen, der andere aus einer TV-Reportage, einer erträumt sie nach dem Genuss eines spannenden Films oder hat bei einer Unterhaltung zu einem bestimmten Thema auf einmal eine zündende Idee für eine Geschichte.
Die Wissenschaft ist sich noch immer nicht ganz schlüssig, woher »Ideen« genau kommen, wie sie entstehen oder wie man ihre Entstehung forcieren könnte, also ist es müßig, sich darüber zu viele Gedanken zu machen.
Aber wenn sie erst mal da ist ... die Idee für einen Roman, eine Geschichte, ein Gedicht ... dann stellt sich vor allem für die Beginner in diesem Beruf die Frage: Und wie geht’s jetzt weiter?
Auch hier ist wie an vielen anderen Bereichen der Schriftstellerei eindeutig festzuhalten: Den einen, den einzig richtigen Weg von der Idee zum Buch ... gibt es nicht.
Es gibt Autorinnen und Autoren, die fangen einfach an zu schreiben und lassen sich überraschen, wohin der Weg sie führt. Sie kennen den Ausgang der Geschichte noch nicht und sind selbst von bestimmten Wendungen im Roman überrascht.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Autor oder Autorin werden ... mein erstes Buch» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.