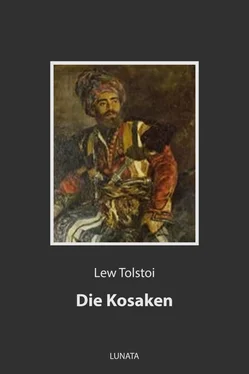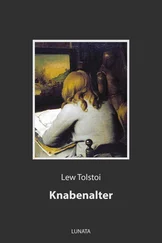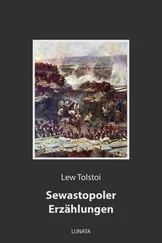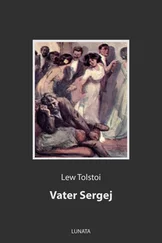LUNATA
Die Kosaken
Die Kosaken
Erzählung aus dem Kaukasus
© 1863 Lew Tolstoi
Originaltitel Kazaki
Aus dem Russischen von August Scholz
Umschlagbild: Cornelius Krieghoff
© Lunata Berlin 2020
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Alles ist still geworden in Moskau. Zuweilen nur hört man da oder dort das Knarren der Räder auf der hartgefrorenen Straße. In den Fenstern ist kein Licht mehr, und die Laternen sind erloschen. Von den Kirchen erschallt Glockengeläut, das in klangvollen Schwingungen über die schlafende Stadt hinflutet und an den Morgen gemahnt. Die Straßen liegen einsam da. Hier und da gleitet eine Schlittendroschke, deren schmale Kufen den Sand der Straße mit dem Schnee vermengen, zur nächsten Straßenecke, wo der Kutscher alsbald, in Erwartung eines Fahrgastes, sanft entschlummert. Ein altes Weib ist zur Kirche unterwegs, wo bereits einige wenige Wachskerzen, unsymmetrisch verteilt, mit rötlicher Flamme brennen und sich in den Goldbeschlägen der Heiligenbilder spiegeln. Das arbeitende Volk erhebt sich bereits nach der langen Winternacht, um an sein Tagewerk zu gehen.
Bei den vornehmen Leuten aber ist's immer noch Abend.
In einem der Fenster bei Chevalier schimmert, der Polizeivorschrift entgegen, unter den geschlossenen Läden hervor Licht. An der Einfahrt halten, außer einer Kutsche, ein paar Schlitten und Droschken, die mit den Hintergestellen dicht zusammengedrängt sind. Auch ein dreispänniger Postschlitten steht dort. Der Hauswart sitzt ganz vermummt und zusammengekrümmt da, als wolle er sich hinter der Hausecke verstecken.
»Was die wohl noch immer zu schwatzen haben!« denkt der Kellner, der mit müdem Gesichte im Vorzimmer sitzt. »Und ich muß nun gerade Nachtdienst haben!« Aus dem anstoßenden, hell erleuchteten Zimmer lassen sich die Stimmen dreier jungen Leute vernehmen, die dort soupieren. Sie sitzen um einen Tisch herum, auf dem sich noch die Reste des Essens und des Weins befinden. Der eine von ihnen, ein kleines, adrettes Kerlchen, mager und häßlich von Gesicht, sitzt da und sieht mit den guten, müden Augen auf den Freund, der im Begriff ist abzureisen. Der zweite, ein Mensch von hoher Statur, liegt neben dem mit leeren Flaschen besetzten Tische lang auf dem Diwan hingestreckt und spielt mit seinem Uhrschlüssel. Der dritte, in einem nagelneuen kurzen Pelz, geht im Zimmer auf und ab, bleibt bisweilen stehen, knackt zwischen den ziemlich dicken und kräftigen Fingern, deren Nägel sauber geputzt sind, eine Mandel auf und lächelt in einem fort; seine Augen und sein Gesicht glühen. Er spricht mit Leidenschaft und gestikuliert dabei, doch sieht man, daß ihm die Worte fehlen – alle Worte, die er findet, scheinen ihm ungenügend, um alles das auszudrücken, was auf sein Herz einstürmt. Immer wieder lächelt und lächelt er.
»Jetzt kann ich ja alles sagen!« sagt der Abreisende. »Nicht, daß ich mich rechtfertigen will, aber ich möchte doch, daß du wenigstens mich so verstehst, wie ich mich verstehe, und über diese Sache nicht so denkst wie all die Banausen. Du sagst, ich sei ihr gegenüber schuldig«, wendet er sich zu dem Kleinen, der ihn mit seinen guten Augen ansieht.
»Ja, das bist du«, antwortet der kleine Häßliche, und sein Blick scheint bei diesen Worten noch mehr Güte und Abgespanntheit auszudrücken.
»Ich weiß, warum du so sprichst«, fährt der Abreisende fort. »Du meinst, geliebt zu werden sei ein ebenso großes Glück wie zu lieben, und es sei genug für das ganze Leben, wenn man dieses Glückes nur einmal teilhaft geworden.«
»Ja, übergenug ist's, mein Herz! Mehr als genug«, bekräftigt der kleine Häßliche, während seine Augen sich abwechselnd öffnen und schließen.
»Aber warum soll man nicht auch einmal selbst lieben?« sagt der Abreisende, in einen nachdenklichen Ton verfallend, und sieht den Freund mit einer Art Mitleid an. »Warum nicht selbst lieben? Aber sie stellt sich nicht ein, die Liebe. Nein, geliebt zu werden ist ein Unglück, ein Unglück, sobald man dabei fühlt, daß man nicht Gleiches mit Gleichem vergilt oder vergelten kann. Ach, mein Gott«, fuhr er mit einer abwehrenden Handbewegung fort, »wenn das wenigstens alles in vernünftiger Weise vor sich ginge – aber weit gefehlt: es vollzieht sich leider nicht nach unserem Willen, sondern sozusagen nach seinem eigenen. Es ist ja förmlich, als hätte ich dieses Gefühl gestohlen! Auch du hast diese Auffassung; sag's nur ganz offen, du mußt sie ja haben! Und glaubst du mir wohl, daß ich von allen Torheiten und Gemeinheiten, deren ich in meinem Leben nicht wenig begangen habe, gerade diese eine nicht bereue und nicht zu bereuen vermag? Ich habe weder mich selbst noch sie belogen, nicht im Anfang noch auch später. Ich glaubte sie schließlich zu lieben, dann aber sah ich ein, daß es eine Lüge – freilich eine unbeabsichtigte – war, wenn ich es behauptete, und ich konnte nicht weitergehen, während sie es tat. Trifft mich darum eine Schuld, weil ich's nicht konnte? Was hätte ich denn tun sollen?«
»Nun, jetzt ist's ja zu Ende!« sagte der Freund, während er sich seine Zigarre anzündete, um den Schlaf zu vertreiben. »Das aber sage ich dir: du hast noch nie geliebt, und weißt nicht, was lieben heißt.«
Der im Pelz wollte wieder etwas sagen und faßte sich an den Kopf. Aber er brachte das, was er sagen wollte, nicht heraus.
»Noch nie geliebt! Ja, es ist wahr, ich habe noch nie geliebt. Aber ich fühle in mir das Bedürfnis zu lieben, ein Bedürfnis, so stark, wie man es stärker nicht fühlen kann. Doch auf der andern Seite – gibt es überhaupt eine solche Liebe? In allem ist doch schließlich etwas Unvollkommenes. Nun, was hilft alles Reden! Ich habe einen schönen Wirrwarr angerichtet in meinem Leben. Aber jetzt ist's zu Ende, du hast recht, und ich fühle, daß ein neues Leben beginnt.«
»In dem du denselben Wirrwarr anrichten wirst«, sagte der auf dem Diwan Liegende, der immer noch mit seinem Uhrschlüssel spielte, doch hörte der Abreisende ihn nicht.
»Ich bin traurig und froh zugleich, daß ich abreise«, fuhr er fort. »Warum ich traurig bin? Ich weiß es nicht.«
Und er begann von sich selbst zu reden, ohne zu bemerken, daß das, was er sagte, für die andern lange nicht so interessant war wie für ihn. Der Mensch ist niemals ein größerer Egoist, als im Augenblick seelischen Entzückens. Er glaubt, es gebe in solch einem Augenblick nichts Schöneres und Interessanteres auf der Welt als seine kostbare Persönlichkeit.
»Dmitrij Andrejewitsch, der Postillon will nicht länger warten«, sagte ein mit Pelz und Gurtbinde angetaner junger Bauer, der ins Zimmer trat. »Seit Mitternacht warten die Pferde, und jetzt ist es vier Uhr.«
Dmitrij Iwanowitsch betrachtete seinen Wanjuscha. Die Gurtbinde, die Filzstiefel und das verschlafene Gesicht des Burschen gemahnten ihn an ein anderes Leben, das ihn rief – ein Leben der Arbeit, der Tätigkeit, der Entbehrungen.
»Nun heißt es also wirklich Abschied nehmen!« sagte er, während er tastend über die Knöpfe des Pelzes fuhr, um zu prüfen, ob auch alle geschlossen waren.
Читать дальше