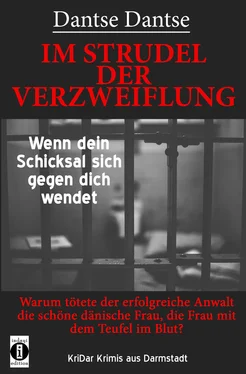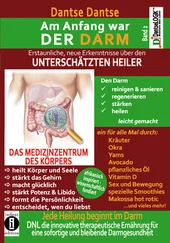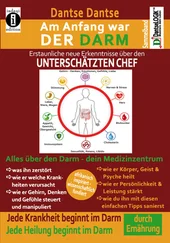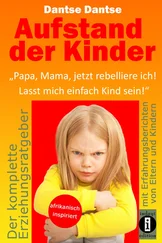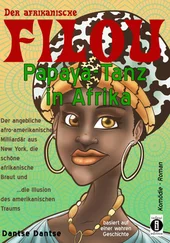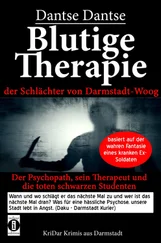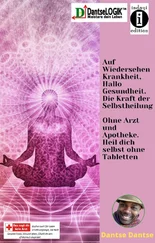In Darmstadt lernte mein Vater auch meine Mutter Margot Mackebrandt kennen. Sie war eine sehr schöne Frau. Ich bewunderte meine Mutter immer für ihre Schönheit und wünschte mir, später auch so eine Frau haben.
Meine Mutter studierte Architektur und mein Vater Volkswirtschaft. Nach ihrem Studium heirateten sie und kurze Zeit später wurde meine große Schwester Mia geboren. Erst 3 Jahre später kam ich zur Welt, der kleine Johnny M. Walker.
Wir lebten damals im Bessungen, in der Nähe des schönsten Parks Darmstadt, der Orangerie.
Wir verbrachten im Sommer wie im Winter sehr viel Zeit in diesem Garten, leider nicht mit unseren Eltern, sondern mit unseren verschiedenen Kindermädchen.
Mein Vater war kaum zu Hause, und wenn er spät abends nach Hause kam, war er immer schon sehr müde. Er spielte ein bisschen mit uns, dann musste er sich die Nachrichten ansehen, und davor mussten wir schon ins Bett gehen.
Meine Mutter kam immer erst, wenn wir vom Kindergarten abgeholt worden waren. Damals, in der Kindergartenzeit, hatte sie einerseits schon mehr Zeit für uns als Papa, aber ich war andererseits immer traurig, dass sie uns kaum selbst abholte, wie es die Mütter meiner Freunde taten. Als wir in die Schule kamen, hatten wir auch mit unserer Mama immer weniger Zeit. Sie arbeitete viel und kam jetzt auch immer spät nach Hause, genau wie Papa.
Wenn wir darüber klagten, warum sie und mein Vater wenig Zeit für uns hatten, sagte sie nur, dass der Papa und sie viel arbeiten müssten, damit es uns gut ginge. Ich sperrte mich dann immer in mein Zimmer ein und fragte mich, warum sie denn jetzt nicht sah, dass es uns nicht gut ging? Sie wollten doch, dass es uns gut ginge, sagte sie – warum ließen sie dann zu, dass es uns schlecht ging?
Aber ich wollte meiner Mutter nichts vorwerfen. Ich wollte ihr nie zeigen, dass ich so traurig war. Ich wollte meine Eltern nicht belasten. Meine Schwester hielt das genauso wie ich. Wir versuchten, das Verhalten unserer Eltern als etwas Gutes zu sehen. Sie wollten uns doch nur Gutes tun. Deswegen taten wir immer so, als ob wir uns freuten, dass unsere Eltern so viel arbeiteten. Im Gegenzug bekamen wir fast alles, was wir wollten, aber auch vieles, was wir nicht wollten oder brauchten. Unsere Eltern zwangen uns regelrecht zu konsumieren, als ob sie damit etwas in uns betäuben wollten. Es kam oft vor, dass mein Vater, wenn er tagelang nicht da war, darauf bestand, mit uns am Samstag in die Stadt zu fahren und shoppen zu gehen.
Wir gingen von Geschäft zu Geschäft. „Sieh mal, Johnny, ist das nicht schön? Das ist das neuste Handy, willst du das nicht?“ „Schau mal hier, Johnny, mein Liebling, sind das nicht spannende Spiele da? Oh, das sind Computerspiele, was meinst du? Ich kaufe dir dann auch einen Computer.“ „Du brauchst eine neue Jacke, die hier sieht aus wie im Katalog, das willst du doch, oder?“ So ging es dann immer weiter, ums Kaufen, Schenken, Geben und Haben. Aber ein neues Handy brauchte ich nicht. Mit wem sollte ich denn dann telefonieren? Ich war erst 10 und unter meinen Freunden verabredeten wir uns direkt nach der Schule. Wozu brauchte ich noch ein Handy? Ich hatte schon drei davon, noch unverpackt in meinem Schrank. Ich wollte nicht Computer spielen. Ich wollte lieber mit ihm in der Orangerie verstecken oder Fußball spielen. Ich liebte Fußball sehr. Mit meinen Freunden traf ich mich oft in der Orangerie, um Fußball zu spielen. Manchmal waren ihre Papas mit dabei, meiner aber fast nie.
Da ich im Fußball gut war, wurde ich beim SV98 aufgenommen. Wir trainierten drei Mal die Woche und hatten am Wochenende mindestens ein Spiel.
Damit ich es einfacher hatte, wie meine Mutter zu mir sagte, wurde ein Auto gekauft und ein Chauffeur eingestellt, der mich ins Training und zu den Spielen am Wochenende fuhr. Nur wenige Male war mein Vater bei einem Spiel dabei.
Ich war traurig, während dem Spiel niemanden zu hören, der meinen Name rief und mich anfeuerte, wie es die anderen Mamas und Papas an der Seite ihrer Söhne taten.
Ich schämte mich ein bisschen, wenn in der Pause alle Eltern mit der Trinkflasche zu ihren Söhnen liefen, ihnen die Flaschen reichten und mit ihnen über das Spiel redeten, um sie aufzubauen.
Es war zum Kotzen, wenn ich nach dem Spiel niemanden hatte, der mir sagen konnte: „Hey Johnny, das war gut, das hast du gut gemacht, du hast den einen da gut ausgedribbelt, deine Flanken waren super!“ Oder auch mit mir schimpfte: „Da hast du Fehler gemacht, dort hättest du mehr kämpfen müssen, schieße nicht immer sofort!“
Ich fühlte mich sehr einsam und der Fahrer redete kaum mit mir. Er fuhr mich hin, verschwand und kam erst wieder, wenn das Spiel fertig war. Unterwegs hörte er seine Musik aus seinem CD Player. Wenn wir zu Hause ankamen, gab er mir die Schlüssel und verschwand. Er war ein Student aus Kamerun. Wir hatten nur eine einzige richtige Unterhaltung, es ging darum, wer der beste Spieler der Welt war. Er sagte Roger Milla aus Kamerun; ich dachte eher an Maradona.
Ich war glücklich, wenn ich zu den Spielen gehen konnte und unglücklich, wenn ich nach Hause kam. Meine Eltern fragten nur: „Wie war es? Habt ihr gewonnen?“ Wenn ich ja sagte, sagten sie auch „Das ist toll“ und fragten weiter, wie ich denn gespielt hätte. Ich antwortete: „Ich weiß es nicht“ und sie kommentierten nicht weiter. Wenn ich aber sagte, wir hätten verloren, dann kam die fast schematisch abgespulte Antwort: „Das ist normal, Verlieren gehört dazu. Man kann nicht immer nur gewinnen.“ Ich verschwand dann sofort wütend in mein Zimmer. War das alles, was sie mir zu sagen hatten?
Meine Mutter kam zu diesen Gelegenheiten in mein Zimmer und versuchte, mich wieder aufzumuntern.
Es klang für mich paradox, als meine Eltern mir sagten: „Johnny, wir sind stolz auf dich. Johnny, du machst das gut.“ Ich sagte mir, wie können sie behaupten, dass ich etwas gut mache, wenn sie gar nicht wissen, nicht sehen, was ich überhaupt mache? Sie versuchten immer, die Familie als etwas Besonderes darzustellen. Wenn wir zum Beispiel im Urlaub waren, klang es in meinen Ohren fast zynisch, wenn sie sagten: „Wir haben es schön, wir sind doch eine glückliche Familie, wir haben es geschafft, wir können uns alles leisten und wir haben zwei tolle Kinder. Wir müssen auf uns alle stolz sein.“ Bei solchen Komplimenten an uns selbst versuchten Mia und ich auch zu lachen und am Ende waren wir fast überzeugt, dachten wir, dass wir doch eine gute Familie waren.
Damals schien es toll, so früh solche Freiheit zu haben. Wir durften alles tun, was wir wollten. In der Schule mussten wir nur die Fächer wählen, die uns gefielen. Ausgehen durften wir, wann wir wollten, mit wem wir wollten. Wir kamen nach Hause, wann wir wollten. Wir waren unabhängig.
Heute sehe ich die Sache total anders. Wir waren noch nicht so weit. Diese verfrühte Unabhängigkeit und so früh Verantwortung zu tragen hat uns mehr Schaden zugefügt, als es uns geholfen hat.
Herr Walker hörte auf zu lesen, schaute nach Anne Schmidt und sagte exklamatorisch: „Aber wir dachten immer, sie freuten sich, das zu tun, was die anderen nicht durften. Das war für uns ein Zeichen, dass wir ihnen vertrauten. Wir wollten, dass sie selbst für sich Entscheidungen treffen konnten und früh erkannten, was sie wollen und was sie nicht wollen, dass sie schon sehr früh ihren Weg erkennen können!“
„ Haben Sie sie jemals nach ihrer Meinung gefragt, ob sie das überhaupt wollten? Diese frühe Verantwortung zu tragen?“, fragte Anne.
„ Wir dachten, es tut ihnen gut“, antwortete Herr Walker leise und las weiter.
Sie meinten immer, dass sie uns vertrauen und dass wir groß genug seien, um allein zu entscheiden, was uns gefällt oder nicht. Somit hatten sie den Druck auf uns abgeladen und ihr eigenes Leben leichter gemacht. Es war doch einfacher für sie, sich auf die Couch zu legen, Fernsehen zu schauen, Zeitungen zu lesen oder zu telefonieren, als sich um die Hausaufgaben zu kümmern. Es war so viel bequemer für sie, als mit uns zu streiten und uns zu zwingen, zu überzeugen, dass wir doch dies oder jenes machen müssten. Es war erholsamer für sie, sich keine Sorgen über uns machen zu müssen, wenn wir zu spät nach Hause kamen. Nein, sie lagen zufrieden im Bett und schliefen.
Читать дальше