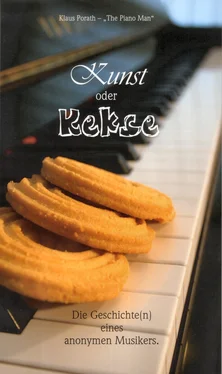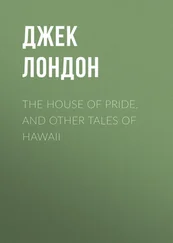Vor kurzem gratulierte mir ein emeritierter Medizinprofessor, der als Chirurg eine Koryphäe auf seinem Gebiet war, zur Relevanz meines Berufes. Er behauptete, ich hätte „an einem Abend 100 Leute glücklich gemacht“. Dieses Kompliment hat mich angerührt, da ich es für bedeutsamer erachte, jemanden zu operieren, als ihm etwas vorzusingen. (Nebenbei, mein Vater soll auch ein ausgezeichneter Operateur gewesen sein.) Fairerweise muss ich hinzufügen, dass auch die wunderbaren Weißweine vom Weingut Rheinterrassen in Guntersblum ihren Anteil an der guten Stimmung des Herrn Professors hatten. Aber: in vino veritas („Im Wein liegt die Wahrheit“)! Dass ausgerechnet zwei Mediziner meine Berufswahl – mein Vater hält mich für einen Versager – so konträr beurteilen, hat mich ins Grübeln gebracht. Wenn ich mir meinen Kontostand angucke, liegt die Wahrheit – wie immer im Leben – irgendwo in der Mitte. Das heißt, mein Vater müsste auf seine alten Tage gar keine komplette Kehrtwendung bezüglich meines Erfolges vollziehen. Die Tatsache, dass ich glücklich bin und dass das letzte Hemd keine Taschen hat, könnte die Basis für einen neu anzuberaumenden Vater-Sohn-Dialog sein.
Meine „Kant-Nachfolge“ lebe ich entscheidend anders als mein Vater. Kants Glaube an einen Schöpfer geht meinem Vater völlig ab. Bei ihm vermisse ich die Reflexion darüber, dass (wie man an ihm bestens sieht) ein strenges Leben nach selbst erkannten und selbstauferlegten Maximen zwar von Erfolg gekrönt sein kann, aber die Gefahr einer emotionalen Enge aufweist. Kant blieb zum Beispiel von Musik völlig unberührt. In meinen Augen war der „Weltweise“ weise genug, nicht zu heiraten. Mit einer Frau und Kindern, also ordentlich Leben in der Bude, wäre er nicht klargekommen. Anders als in meinem Elternhaus sah ich es als einen Segen an und genoß es, dass meine Ex-Frau ganz anders geprägt war als ich. Sie brachte dadurch eine mir nur in der Musik bekannte Weite in unser gemeinsames Leben. Als Paar und für unsere Kinder ergänzten wir uns darum phantastisch. Jedenfalls so lange, bis sie das eines Tages anders sah..
Im Gegensatz zu meinem Vater bin ich mir bewusst, dass ich als „verlässlicher Erbsenzähler“ wie eine Maschine funktioniere. Wenn ich unter der Dusche stehe und das Shampoo alle ist, greife ich zur (selbstverständlich!) bereitstehenden neuen Flasche und notiere mir nach dem Föhnen, Shampoo zu besorgen. Das ist perfekt, anstrengend und auf keinen Fall normal. Ich weiß das, mein Vater nicht. Wir beide können aber nicht anders. Mit dieser Präzision kann und sollte man ganze Handelsketten leiten oder U-Bootflotten kommandieren. Beides wurde mir leider bisher noch nicht angeboten…
Meinen Vater und mich unterscheidet, dass ich generell andere Menschen so lasse, wie sie sind. Ich beobachte meine Mitmenschen sehr genau und bin fasziniert davon, wie sie es auf ihre Weise fertigbringen, im entscheidenden Moment ebenfalls nicht ohne Shampoo dazustehen.
Mein Vater macht in meinen Augen den Fehler, seine vielen zweifelsohne richtigen Erkenntnisse automatisch auf den Rest der Menschheit zu übertragen. Alle sollen sich am besten so verhalten wie er. Verstärkt dadurch, dass er nicht an Gott glaubt, spielt er ihn selbst und ist darum von anderen oft nur schwer zu ertragen. Ich kann über mich selber lachen und wünschte, mein Vater könnte das auch. Über mich lacht er schon genug, ich wünschte mir, er würde auch mal über sich selbst lachen.
Erst, wenn Sie ihr zartes Miezekätzchen mal versucht haben zu baden und hinterher das Blut von Ihren Händen und Unterarmen abwischen, wissen Sie, dass es Krallen hat und sehr stark ist. Genau das erleben manche Menschen mit mir. Ich springe nicht nach jedermanns Pfeife, ich tue grundsätzlich nur das, wovon ich überzeugt bin. Man erlebt mich fast immer gut gelaunt, so dass es Menschen gibt, die bisweilen völlig überrascht sind, dass es auch bei mir den Moment gibt, ab dem mit mir nicht mehr gut Kirschen essen ist. Wer auf mich einwirken möchte, schafft das nur mit vernünftigen Argumenten.
„Gefühlte Wahrheiten“ durchschaue ich in Lichtgeschwindigkeit. Ich lasse niemanden seine schlechte Laune und ungelösten Probleme an mir abreagieren. Diese Klarheit, ausgerechnet bei einem Musiker, findet man wohl eher selten. Anders kann ich mir nicht erklären, weshalb sie mir (von einem Freund und von meiner Ex-Frau) schon die Beschimpfung, ich hätte besser Staatsanwalt oder Professor werden sollen, eingehandelt hat. Jura wäre für mich vermutlich tatsächlich das richtige Studium gewesen. Dieses klare „Standing“ hilft mir alleine da draußen, nur mit einem Klavier „bewaffnet“, auftretende Konflikte schnell zu lösen und dann weiter gute Laune zu verbreiten. Dass mich nichts so leicht aus der Bahn wirft, verdanke ich zum anderen der grenzenlosen Liebe meiner Oma Paula, von der ich gleich berichten werde.
So, geschafft!! Werten Sie dieses Kapitel einfach als mein Outing als verkappter Intellektueller. Vielleicht waren meine Semester an der Uni doch nicht ganz für die Katz?

Mit meinen Eltern in einem Nachtclub auf Gran Canaria,1979.
1966: Das Licht der Kreissaallampe blendet mich zu früh.
Im Gegensatz zu mir kam meine ältere Schwester Barbara 1963 als Wunschkind zur Welt. Das ist verwunderlich, da meine Eltern damals als Ärzte im Praktikum ein Nomadenleben führten. Sie ließen den Säugling und später das Kleinkind in den verschiedenen Krankenhäusern, in denen sie Dienst schoben, von wechselnden Krankenschwestern versorgen. In unserer Familie wurde später freudig davon erzählt, wie niedlich es war, als meine Schwester in der Schweiz anfing Schwizerdütsch zu sprechen. Die Bedeutung von ,Mutter‘ in ,Muttersprache‘ erschloss sich den Doktoren Porath nicht.
Ganz wohl kann mir in meiner Mutter nicht gewesen sein, denn ich verließ sie zu früh und verbrachte die letzten Wochen bis zum errechneten Schlupftermin in einem Brutkasten. Eine weitere medizinische Herausforderung war, dass mir aufgrund einer Unverträglichkeit der Blutgruppen meiner Eltern direkt nach der Geburt das gesamte Blut ausgetauscht werden musste. Dieses spendete, so wurde mir später berichtet, ein Soldat, bei dem ich mich an dieser Stelle aufrichtig bedanken möchte. Dem armen Mann habe ich damals vermutlich gehörig den Feierabend verdorben. Hoffentlich bekommt er auf irgendeinem Wege dieses Buch in die Hände und erfährt, dass sich sein Einsatz in Celle am 5. März 1966 gelohnt hat. Finde ich zumindest. Nach jüdischem Glauben befindet sich im Blut die Seele. Vielleicht liegt hierin der Grund für meine Affinität zum Militär, die meinen Freund Matthias immer aufs Neue verwundert. Als wir uns kennenlernten, habe ich ihm immer wieder in nächtelangen Gesprächen versucht, den Wert von Kameradschaft zu vermitteln. Irgendwann gab ich entnervt auf. Das war, kurz nachdem er zum Oberstleutnant befördert wurde.
Aber zurück zum neuen Erdenbürger (ohne Uniform). Mein Überleben stellte meine Eltern vor eine logistische Herausforderung: Wohin mit dem Kleinen? Konnten sie erneut examinierte Krankenschwestern als ehrenamtliche Ammen einspannen? Zu meinem großen Glück nicht, denn meine Schwester war bereits 2 1/2 Jahre alt und die Krankenschwestern keine Ammen mehr, sondern Erzieherinnen. Also kamen meine Eltern auf die allerbeste Idee ihres Lebens, für die ich mich bei ihnen an dieser Stelle herzlichst bedanken möchte. Sie gaben mich bei der Mutter meiner Mutter, der liebsten Oma der Welt, meiner Oma Paula, in Pflege. Meine Bilderbuchkindheit konnte beginnen.
1966 bis 1971: Glückliche Kindheit in Celle – Omas Goldjunge und doofe Kekse.
Читать дальше