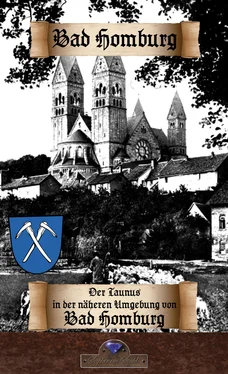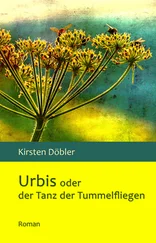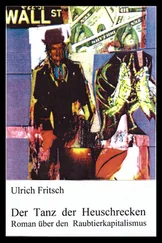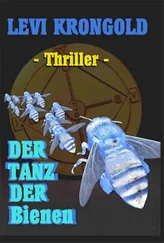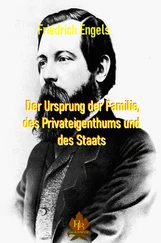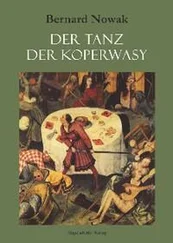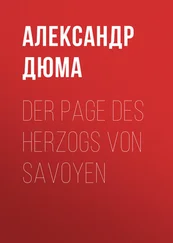Ich nehme indessen hier noch Gelegenheit, den Gegenstand nachträglich zu erwähnen, wodurch denn die mehrfach im Texte vorkommende Angabe von dem Mangel aller organischen Reste im Gebiete des Taunus bis zur späteren völligen Feststellung der Sache ihre vorläufige Modifikation erhält. Mein Exemplar von Quarzgestein mit Petrefacten stammt aus einem Steinbruch im Rodheimer Wald.
Eine kleine Berichtigung bedarf ferner auch meine Angabe über das Vorkommen von Torf im Amt Homburg. Ich bin nach Abdruck des Textes von einem Freunde des Fachs darauf aufmerksam gemacht worden, dass die torfige Beschaffenheit des Bodens in den unteren Audenwiesen um die Quellen hin eine Erwähnung verdient hätte, indem dies ein gewisses, nicht zu vernachlässigendes Moment für die Vergleichung der Quellen mit dem Boden biete, den sie durchströmen. Es sey namentlich beim Graben der grossen Cisterne am Brunnensaale eine ansehnliche Lage Torfboden durchbrochen worden. Der zähe graue Thon, (wahrscheinlich oberer Braunkohlenthon) welcher hier im Thale den Untergrund bildet, bietet allerdings auch als gering wasserdurchlassender Boden ganz die zur Torfbildung nöthigen günstigen Bedingungen dar. Auch im Gebirge sind hie und da einzelne grössere morastige und torfige Gründe anzutreffen, wie im schwarzen Bruch, in den Röderwiesen u. s. w. An letzterem Orte soll ehedem auch wirklich eine Torfgewinnung versucht worden seyn.
Noch bemerke ich nachträglich, dass die Höhenangaben einiger Punkte des Gebirgs der grossen Stumpffischen Karte entnommen sind. Genauere Angaben über diesen Gegenstand findet man u. a. im Jahrbuch des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, 4ter Jahrgang.
Homburg v. d. Höhe, 1850.
Friedr. Rolle.
Inhalt.
Erster Abschnitt.
Das Gebirge im Allgemeinen
Bergformen
Befestigungswerke der Alten
Zweiter Abschnitt.
Geognostische Beschaffenheit des Taunus im Allgemeinen
Geognostische Beschaffenheit des Amts Homburg im Besondern
Aeltere Bildungen. Uebergangsgebirge des Taunus.
Schiefergesteine des Taunus
Quarzgestein des Taunus
Besondere Lagerungs- Verhältnisse von Schiefer und Quarzgestein
Altersverhältnisse der Taunusgesteine überhaupt.
Quarzfels auf Gängen
Brauneisenstein im Gebiete der Taunusgesteine.
Alter Bergbau im Gebiete der Taunusgesteine.
Die Gebirgserhebung
Dritter Abschnitt.
Jüngere Bildungen
Basalt und Braunkohle um Homburg
Diluvium
Jetztwelt
Vierter Abschnitt.
Die Mineralquellen
Die Gesteine des Amts Homburg in ihren Beziehungen zu den Mineralquellen
Fünfter Abschnitt.
Zusammenstellung der Mineralien des Amts Homburg
Erster Abschnitt.
Das Gebirge im Allgemeinen.
Die malerische Gebirgskette des Taunus oder der Höhe erstreckt sich von der Wetterau, von Nauheim und Friedberg her, unweit Homburg vorbei nach Südwest hin, wo sie durch den Rhein von dem geognostisch ihr verbundenen Hundsrück getrennt wird.
Hin und wieder fasst man wohl die Ausdehnung des Taunus weiter und benennt so das ganze bergige Hochland innerhalb der Haupttaunuskette, dem Rhein und der Lahn. Es soll aber hier um so mehr von dieser zu weit getriebenen Ausdehnung abgesehen werden, als die Hauptkette, der im engern Sinne allein der Name zukommt, gerade geognostisch ganz gesondert von der übrigen Gegend bis zur Lahn hin betrachtet werden muss.
Vorberge und Ausläufer, in der Entfernung sich mehr und mehr in die Ebne verlierend, reihen sich dem Hauptgebirgszuge an, der unweit Königstein und Falkenstein mit den drei genäherten Kuppen Feldberg, Lidgenfeldberg und Altking seine grösste Höhe und Mächtigkeit erhält.
Dieses Gebirge, der Taunus mons des Tacitus und Pomponius Mela, kann als Grenzscheide von Nord- und Süddeutschland gelten, wie es einst auch die des Römerreichs und der nicht unterworfenen deutschen Stämme gewesen. Hier zog sich ehedem die verschanzte Grenzlinie der Römer hin und bildet noch jetzt in ihren Trümmern unter dem Namen „Pfahlgraben" auf eine grosse Strecke hin die Grenze des Amts Homburg vom Herzogthum Nassau. Der Name „Taunus" scheint sich wohl am ungezwungensten von „Taun, Zaun“ ableiten zu lassen, weil dieses Grenzgebirge seit uralten und vermuthlich selbst wohl vorrömischen Zeiten verschanzt und gleichsam „verzäunt“ gewesen ist.
Endlich ist noch eine Grenze anderer Art auf dem Hauptzuge des Taunus theilweise zu finden, die Wasserscheide des Main- und Lahngebiets.
Unser Gebirge erreicht auf Hessen-Homburgischen und Nassauischem Gebiete, drei starke Stunden von der Stadt Homburg, seine grösste Höhe mit dem grossen Feldberg, gemeiniglich schlechtweg „Feldberg“ genannt, welcher sich 2654 Pariser Fuss über das Meer erhebt. Von andern Höhepunkten dieses Theils des Taunus führe ich nach Vorgang andrer an:
Lidgenfeldberg, kleiner Feldberg 2490.
Altking, Altkönig 2394.
Klingenkopf 2081.
Herzberg 1828.
Rothenberg 1762.
Gückelsburg 1460.
Bleibeskopf 1454.
Salburg 1304.
an der Goldgrube 1204.
Stadt Homburg 600.
Bergformen.
Die Form der Berge ist vorwaltend die flacher gedehnter Kegel, welche bisweilen, wie das u. a. beim Feldberg der Fall, sich auf den Gipfeln zu ziemlich breiten Hochebnen verflachen.
Ein eigener und gemeinsamer Rücken des Gebirgs besieht nicht, indem alle Kuppen durch kleine hochliegende, nicht sehr tief eingesetzte Thäler getrennt sind, wobei dann einzelne wohl noch bedeutend über die gewöhnliche Linie sich erheben. Die Wasserscheide folgt hier keinem zusammenhängenden Rücken, sondern greift mehrfach in die jenseitige Abdachung über.
Der Abfall nach der Mainebne ist ziemlich rasch und steil, wenn auch sonst dabei schroffe zackige Berggestalien nicht gerade häufig sind. Steil fällt in der Nähe Homburgs das Gebirge au der Goldgrube und mehr noch an dem Marmorstein.
Die beiden das Gebirge bildenden Felsarten, thonige Schiefer und Quarzgesteine, unterscheiden sich im Allgemeinen bestimmt in den Bergformen. Sehr deutlich wird dies durch den Anblick des Höhenzugs schon von Frankfurt und dem Mainthale aus: die Berge links und rechts der dreiteiligen Hauptgruppe von den beiden Feldbergen und dem Altking unterscheiden sich bemerklich in der äusseren Form. Rechts sind es langgezogene flache Rücken, die in einander zu verfliessen scheinen und deren keiner anders denn als breiter gewölbter Rücken hervortritt. Das macht aber, weil in diesen Bergen rechts von der Hauptgruppe das Quarzgestein so gut wie allein die innere Masse bildet. Zur linken des Feldbergs aber fällt eine steilere mehr regelmässig kegelige Form der Berge auf: hier sind thonige Schiefer die herrschende Felsart.
Sonst indess, zumal bei geringeren Höhen, bildet der Schiefer um Homburg herum nur ganz sanft abgeplattete Bergformen, die nie das Gestein in Felsmassen anstehend zeigen, sondern nur in geringer "Ausdehnung aus der Vegetationsdecke hervortreten lassen, es sey denn, dass dasselbe durch die Thalbildung entblösst werde.
Читать дальше