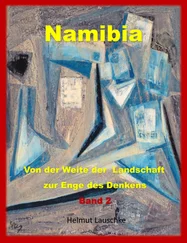Die Römer hatten rabiat die Zufahrt verbreitert und geglättet, um ihre Angriffe vortragen zu können. Ihre Belagerungswerke und Maschinen schienen heute nur von Wachmannschaften besetzt zu sein. Eigentlich ein Anblick, der einen energischen Ausfall förmlich herbeischrie. Wenn ich noch genügend Männer gehabt und wenn die noch über irgendwelche Kräfte verfügt hätten, ich hätte nicht gezögert. Auch am ersten Tag und noch einmal danach hatte es dort draußen eine ausschweifende Feier gegeben, mit reichlich Hörnertuten und Blechmusik, den grellen Posaunen als Höhepunkte. Jetzt begann auch der Widerschein der Feuer in den Himmel zu leuchten. Der Seewind hatte sich früh aufgemacht, als trage er Sorge, der Geselligkeit den heißen Sonnenglast vom Halse zu schaffen. Vielleicht wollte er aber auch bloß nach Art fahrender Sänger von saftdurchtränkten, kräutergewürzten Genüssen künden, die jede Vorstellung übertrafen und anderen, Glücklicheren vorbehalten blieben. Dabei kam uns nur etwas zu, wenn die von West einfallende Brise mal zufällig ein wenig nach Süden schlenderte. So wurden wir von der lässigen Beiläufigkeit des Boten, der vom ebenso unbekümmerten Treiben der Feinde kündete, zusätzlich verspottet. Ich wandte mich ab und hockte mich in den Schutz der Brüstung. Ich hatte meine Nase genug über die Mauer gehängt. Heute Nacht würden sie kommen. Satt, ausgeruht, mit kalten Herzen und frisch geschliffenen Waffen. Ich wischte ein Plätzchen sauber, zielte mit dem Hintern und lehnte den Rücken an.
Seit meiner Rückkunft aus Rom und erst recht seit der Wahl zum Strategen hatte sich der Sinn meines Lebens verloren wie eine Kamelspur in den arabischen Dünen. Wohin sich wenden? Ratlosigkeit war die schlimmste aller Sorgen. Denn was bedeutete sie? Von Gott verlassen zu sein! Nein, nicht verlassen natürlich, allein gelassen. Das war eine Premiere und sie war entsetzlich. Immer war bisher in meinem Leben rasch klar geworden, was Gott von mir wollte, welche Saat auszubringen, welche Ernte einzuholen war. Das hatte sich in Galiläa gründlich geändert. Von einem Sabbath auf den anderen war ich ausgesetzt worden. Tag um Tag hatte ich mich wirklich verlassen gewähnt und im Geheimen kläglich nach Gott geschrien, für mich einsame, elende, ängstliche Seele wenigstens Trost erfleht um der Unschuld und Redlichkeit willen. Erst spät war mir aufgefallen, dass ich zu wenig nachdachte und entschieden zu viel den Jeremias gab. Ich dachte nicht als Stratege, der ich doch angeblich war. Gott hatte mich ausgesetzt. Gut. Das bedeutete: Nun hilf dir selbst! Also hatte ich selbstständig aus eigener Beurteilung aller Umstände Gottes Willen zu erschließen, Schritt für Schritt. Das führte mich eindeutig auf eine höhere Stufe der Bewährung. Meine lange, sorgfältige Ausbildung machte wieder Sinn, allein, indem sie sich fortsetzte. Ich saß nicht mehr krumm auf meinem Pferd. Was war mit der Klärung der Lage gewonnen? Im Sattel eine gute Figur zu machen, war eine Sache, die richtigen Befehle zu geben eine ganz andere. Ich versuchte, den Mahnungen der Presbyter der Friedenspharisäer treu zu bleiben. Mauern gegen Räubergesindel bauen, Vorräte anlegen, Mäßigung und Ruhe verbreiten. Jochanan, der Älteste, hatte es in die Worte gefasst: »Du solltest durch vorausschauende Selbstbeschränkung dem unausweichlichen Gang der Dinge einen friedlichen Verlauf ermöglichen.«
Aber die Frage blieb nach wie vor: Was wollte Gott von mir? Tatsache war, dass meine anfängliche Verzweiflung noch bei Weitem übertroffen wurde durch die sich spätestens auf dem Weg nach Jotapata einschleichende Erkenntnis, dass eigentlich nichts anderes übrig bleibe, auch bei sorgfältigster und wiederholter Prüfung, was letzten Endes zu tun wäre, als in der Schlacht zu sterben. Also hatte ich mich entrümpelt in tiefer geistiger Nacht, bis ich leer war wie eine gut gefegte Geniza. Ich hatte akzeptiert, dass damit meiner Bestimmung eine Magerkeit zugewiesen wurde, die fast schändlich war, zutiefst verletzend, weil schmerzhaft ungerecht. Meine Bestimmung war so mager wie ich selbst. Bis hier nur sollte ich kommen und nicht weiter. Gott bedurfte meiner nur in minderem Ausmaß. Legen musste sich meiner Wogen Stolz. Grausame Erkenntnis, die aber gerade dadurch zusätzliche Katapulte von Lanzen der Selbstanklage aufrichten half: Was beschwerst du dich eigentlich? Du hast etwas an Gottes Verfügungen auszusetzen? Interessanter Gedanke! Zu wenig Selbstherrlichkeit für den großartigen Josef, was? Ja, ich war hart mit mir ins Gericht gegangen, und als ich auf diese Weise auch die letzten Körnchen Schmutz aus Ritzen und Ecken gefegt, hatte ich mein Schwert gezogen, um vor Gott zu treten. Ohne jede Hoffnung, mit nur wenig, eher gespannter, aufgeregter Furcht, hatte ich mich fortan immer mit den Ersten hinausgestürzt ins Gefecht, vom ersten Tag an, fast sieben Wochen lang. Jeden Augenblick hätte ich hinaufsteigen können, unter mir meine leere, bescheidene, zeitweilige Bleibe zurücklassend: durchbohrt, zerhackt oder eingedrückt. Jeder Herzschlag hätte der letzte sein können.
Doch Gott hatte mich abgewiesen. Mit feiner Ironia hatte mich so mancher Pfeil beim Verfehlen am Hemd gezupft, mit krachendem Spott hatten Steine meinen Helm bloß gestreift, mit grobem Witz hatte ein Speer mich zwischen den Beinen am Rocksaum an eine Planke geheftet, sodass die Rede ging, die Römer, da sie mich sonst nicht anders zu fassen kriegten, hätten versucht, mich an der Vorhaut festzunageln, jedoch in der Hitze des Gefechts vergessen, dass ich beschnitten sei. Erst gestern hatte ich den Vorstellungen Jakobs nachgegeben, unserem verrückten Plan und meiner eigenen Idee zugestimmt. Gott schätzte keine Überheblichkeiten, er wollte nur eines, meine Hilfe, auch wenn mir als Konsequenz daraus schwindelig wurde. Denn wenn mein Dienst weiterging, so gab es nur noch eine einzige Möglichkeit dazu, einen einsamen Weg, der hinaufführte ins Gebirg, den kein Steinbock, der bei Verstand war, wagen würde. Schmal, gefährlich, nein halsbrecherisch, ein Aufstieg ins Blaue hinein.
Jakob!
Ich sah Jakob die Außentreppe des »Josias«, des linken Nordturms, heraufkommen. An den Wachen vorbei, die vor sich hin dösten, winkte er herüber. Jakob, keine zwanzig, stammte aus Leptis Magna und hatte im Fuhrunternehmen seines Vaters Reisende mit den Sehenswürdigkeiten des Drei-Städte-Landes bekannt gemacht. Von der Lektüre der Makkabäerbücher berauscht, insbesondere vom Schicksal der Witwe Hannah und ihrer sieben Söhne, hatte er sich bei Ausbruch des Krieges eingeschifft, dorthin, wo es aller Wahrscheinlichkeit nach zu den ersten Kampfhandlungen kommen musste, nach Galiläa. Anfangs kreiste er am Rande meiner Leibwächter. Je mehr von ihnen fielen, desto näher kam er mir. Seit einer Woche war er der Letzte meines privaten Gefolges.
Anführer und letzte Leibwache waren während aller Kämpfe bisher ohne die kleinste Verletzung geblieben. Dafür hatten sich unsere Körper in alle Farben des Regenbogens gekleidet und auf den wunden Stellen half keine Salbe und kein Schwamm. An einem Tag wie heute, da das Schicksal Luft holte, einem Tag der Ruhe, meldeten sich alle Körperlichkeiten bis hin zu den feinsten Fasern und kleinsten Knöchelchen, von deren Dasein man nie etwas geahnt hatte. Angemessen war, der eigenen Befindlichkeit das an Augenmaß und Pflege zu widmen, was zum Erklimmen des ominösen Weges erforderlich schien.
Jakob brachte Abendbrot. Die Pampe, von der wir uns ernährten. Sie wurde auf ärztliche Anweisung angerührt, weil so die Flüssigkeit am längsten im Körper verbleiben würde. Unser Wasser ging zur Neige, auch aus blindem Kampfeseifer. Wenn man den Feind entmutigen will, lässt man sich zu manch einer Verschwendung hinreißen, die man im Nachhinein bitter bereut. Unsere Kehlen waren trocken wie Tonscherben, und die Zungen klebten an unseren Gaumen. Wenn man die Haut vom Brustbein abhob, brauchte sie immer länger, um zum Körper zurückzukehren. Jakob reichte mir einen Henkelmann, äugte zum Römerlager hinüber und setzte sich neben mich.
Читать дальше