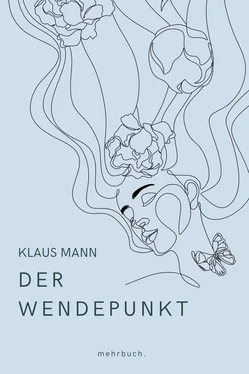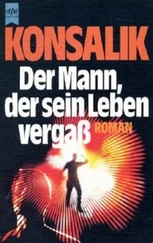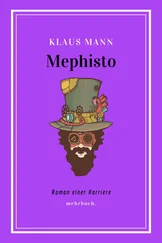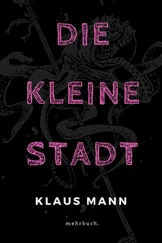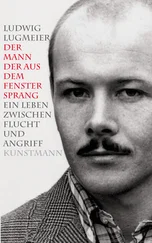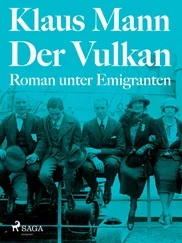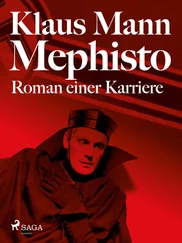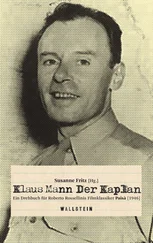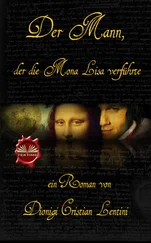Klaus Mann - Der Wendepunkt
Здесь есть возможность читать онлайн «Klaus Mann - Der Wendepunkt» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der Wendepunkt
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der Wendepunkt: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der Wendepunkt»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht ist die zweite Autobiografie nach Kind dieser Zeit von Klaus Mann. Der Titel endet mit Klaus Manns Entscheidung zum Eintritt in die US Army. Der Titel bezieht sich auf Manns Ansicht, jeder Mensch habe an bestimmten Lebenspunkten die Möglichkeit, sich für das eine oder andere zu entscheiden und damit seinem Leben eine bestimmende Wendung zu geben. In seinem Leben war das die Wandlung vom ästhetisch-verspielten zum politisch engagierten Schriftsteller.
#wenigeristmehrbuch
Der Wendepunkt — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der Wendepunkt», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das Kinderfräulein ist eine der Hauptmythen meiner Kindheit. Sie ist empfindlich, hochmütig und launenhaft, zuweilen liebenswert, dann wieder erschreckend. Wenn sie sich ärgert oder Kopfweh hat, erstarrt ihr Gesicht zu einer aschfarbenen Maske; aber sie kann auch strahlen. Alle scheinen sich ein wenig vor ihr zu fürchten, sogar die Eltern. Ihre vorwurfsvolle Miene gemahnt uns daran, daß sie im Hause des Baron Tucher wie eine Prinzessin gehalten wurde, die Zöglinge folgten aufs Wort, dort war das Fräulein glücklich. Der Baron (er war blind, wie das Fräulein sich mit respektvoller Rührung erinnert) verzog mit seinen Mustersöhnchen nach Kanada nicht ohne die unschätzbare Gouvernante aufs herzlichste zum Mitkommen aufzufordern. »Wär ich doch mit den Tuchers gegangen!« seufzt sie nun. Wir haben es wohl wieder einmal an der nötigen Ehrerbietung fehlen lassen. »Dann müßt ich mich nicht so viel kränken …« Sie weint ein bißchen, und auch uns werden die Augen feucht. Wir begreifen, daß die Gute uns ein großes, schweres Opfer bringt, indem sie auf Kanada verzichtet und bei uns bleibt »in diesem saloppen Künstlerhaushalt«. Keine andere würde es bei uns aushalten. – Dies wird uns immer wieder aufs eindrucksvollste versichert. »Wenn ich einmal nicht mehr da bin«, sagt das Fräulein (man weiß nicht ganz, ob sie an ihren Hintritt denkt oder nur an einen Stellungswechsel), »dann werdet ihr ja sehen, was aus euch wird. Die nächste hält es hier keine vierundzwanzig Stunden aus. – Oder sie sorgt dafür, daß ihr Disziplin lernt. Dann ist Schluß mit der Schlamperei! Ihr werdet Augen machen …« Uns wird bange ums Herz. Wir flehen das Fräulein an, uns doch bitte ja nicht zu verlassen. Sie ist mild und weise; ihre Nachfolgerin wäre vielleicht ein Drache, ein wahrer Ausbund an Tücke und Grausamkeit …
Sie waren sich alle gleich. In imposanter Parade folgten sie einander, von der legendären Blauen Anna bis zu jenem hochbeinigen, spleenigen Geschöpf, das wir »Betty-Lilie« nannten, wegen ihres delikaten Teints und Charakters. Die Chronik unserer Kindheit ließe sich in fünf bis sechs Perioden einteilen, nach den wechselnden Regimes der Gouvernanten; man könnte von einer »Blauen-Anna-Periode« oder einer »Betty-Lilie-Ära« sprechen wie von der Elisabethanischen Zeit oder der Victorianischen Epoche. Natürlich unterschieden sich die hohen Frauen in Einzelheiten voneinander, aber was sie gemeinsam hatten, war tiefer und wesentlicher. Alle schwelgten sie in der Erinnerung an einen idealen Haushalt, dem sie einst in führender Stellung angehört hatten, das Palais eines ehrwürdigen Barons oder Kommerzienrates, wo es zugleich sittsam und lustig zugegangen war. Alle bemerkten sie mit demselben gönnerhaften Lächeln, daß unsere Eltern »sehr interessante Menschen« seien, wobei sie diskret auf den Unterschied anspielten, der zwischen unserer Bohemewirtschaft und dem tadellosen Haushalt des Kommerzienrates nun einmal leider bestand. »Andere Kinder« waren kräftig, brav und wahrheitsliebend, im Gegensatz zu uns wilden und heuchlerischen Schwächlingen. »Andere Kinder« verstanden Spaß und wußten eine Tracht Prügel einzustecken; sie putzten sich die Zähne mindestens dreimal täglich, gingen zur Kirche, aßen angebrannten Grießbrei ebenso gern wie Schokoladentorte und waren ihrem Fräulein zärtlich-ehrerbietig zugetan.
Wir konnten andere Kinder nicht leiden. Es war erst viel später, als ich etwa zwölf Jahre alt war, daß wir anfingen, Freunde zu haben. Anfangs hatten wir durchaus an uns selbst genug.
Erika und ich wurden in eine Privatschule geschickt – ein etwas prätentiöses kleines Etablissement von altmodisch-muffiger Gediegenheit, wo die Sprößlinge der Münchener beau monde die Kunst des Lesens und Schreibens erlernten. Schule, in diesem vorbereitenden Stadium, bedeutete weder Spaß noch viel Plage. Das bißchen Wissenschaft – Alphabet, Einmaleins, die Geschichte vom Herrn Jesus – war leicht genug zu begreifen. Die Lehrerin, eine alte Jungfer mit glattem grauem Scheitel und säuerlich-pedantischer Miene, konnte als komische Figur aufgefaßt werden. Was unsere Mitschüler betraf, so hatten wir nur wenig Kontakt mit ihnen. Sie waren nicht eingeweiht in die Geheimnisse unserer Spiele; sie schienen eine andere Sprache als wir zu sprechen.
Unsere Spiele waren komplizierter als die Fibel, aufregender als die groben Belustigungen, die unter Kindern sonst wohl üblich sind. Es waren eigentlich keine »Spiele«; vielmehr handelte es sich um eine großangelegte, sorgfältig ausgesponnene Phantasmagorie, ein mythisches System innerhalb des Kindheitsmythos. Es beruhte auf zwei verschiedenen Sagenkreisen, die ineinander griffen und allmählich miteinander verschmolzen. Der erste Kreis umfaßte unsere eigene Welt – das Haus, den Garten, die Eltern, das Kinderfräulein –, während der zweite das Reich der Puppen und der Hunde in sich schloß.
Das erste Spiel ging auf einen sentimentalen Schmöker zurück, den Fräulein Betty uns einmal vorgelesen hatte. Das Buch – es hieß »Kapitän Spieker und sein Schiffsjunge« – machte uns einen so tiefen und nachhaltigen Eindruck, daß wir heute noch lange Stellen daraus auswendig wissen. Es war nicht so sehr die abenteuerliche Handlung, die uns bezauberte, wie das Milieu, in dem die Geschichte sich zutrug – die zugleich romantische und mondän-luxuriöse Sphäre des großen Ozeandampfers. Das Schiff, in das sich unser Haus und Garten verwandelten, war genau dem Kapitän-Spiekerschen Modell nachgebildet. Affa und die anderen Mädchen wurden in unserer Phantasie zu rüstigen Matrosen; Mielein war eine Art von eleganter Hausdame oder Oberaufseherin, während dem Zauberer natürlich das Amt des Kapitäns zufiel, der sich meistens im Heiligtum der »Betriebskabine« verborgen hielt. Es gab nur vier Passagiere – zwei kapriziöse Damen, Prinzessin Erika und Mademoiselle Monika, und zwei Herren von hohem Rang und unermeßlichem Reichtum, die Steinrück und Löwenzahn hießen. Es machte Golo und mir großen Spaß, diese zwei großartigen Weltenbummler zu personifizieren und das eigene Benehmen ihrem pompös-spleenigen Stil anzupassen. Sie waren keine frivolen Draufgänger, unsere reisenden Millionäre; vielmehr handelte es sich um zwei Herren gesetzten Alters, die eine schwere Last von Verantwortlichkeiten und väterlichen Sorgen zu tragen hatten. Kurze, aber inhaltsschwere Radiogramme informierten sie über die beunruhigenden Schwankungen an der Börse; atemlose Geheimboten überbrachten furchtbare Bulletins, das Betragen der fernen Söhne betreffend. Diese jungen Leute – typische Repräsentanten frivol-sybaritischer jeunesse dorée – verschwendeten Millionen für grandiose Ankäufe von Karamelbonbons und Schokoladentorten, worüber die geplagten Väter, nebeneinander auf dem Promenadedeck spazierend, sorgenvoll die Köpfe schütteln mußten.
Mein Sohn Bob war eine hübsche Puppe aus Zelluloid, sehr süß und albern, mit aufgerissenen, lachenden blauen Augen und schelmischen Grübchen in den rosa Backen. Ich liebte ihn heiß und hätte um die Welt nicht eine Nacht ohne ihn geschlafen. Seine Funktionen in meinem Leben waren mannigfacher und komplexer Art. Erstens war er mein geliebtestes Spielzeug und höchst geschätzter Besitz; zweitens gehörte er zu den Hauptfiguren, nicht nur in der »Gro-Schi« (Großes Schiff)-Welt, sondern auch in dem anderen Legendenkreis, den wir durch die Jahre hindurch entwickelten und weiterspannen. In diesem zweiten Mythos erschien der Zelluloid-Adonis als Sohn und Retter des greisen Königs Motz, dessen Leben und Reich von einer feindlichen Koalition bedroht war – dem grimmen Heere der Amazonen, als deren Anführerin unser Fräulein figurierte, und der Kohorte böser Gassenjungen, die uns auf dem Spaziergang zu belästigen pflegten.
Leider war Prinz Bob nicht so tugendhaft wie mutig. Nach gewonnener Schlacht erging er sich gerne in allerlei üppigen Zerstreuungen, unter denen der übermäßige Genuß von Cremetörtchen die kostspieligste und unmoralischste war. Kurzum, der strahlende Held und Erbe war zugleich ein rechtes Sorgenkind und ein leichtsinniger Taugenichts, der eine Menge skandalöser Unkosten verursachte. Und es war eben in dieser Eigenschaft – in seiner Rolle als schlemmerischer Prinz Charming – daß mein Zelluloid-Bob in der eleganten Sphäre des Passagierdampfers Zutritt fand. Seine liebenswürdige, wenngleich korrupte Persönlichkeit verband die beiden Regionen, den mondänen Dampfer und das kriegerisch-heroische Traumland.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der Wendepunkt»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der Wendepunkt» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der Wendepunkt» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.