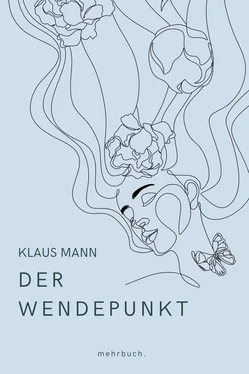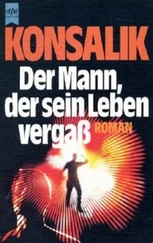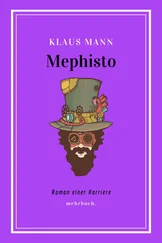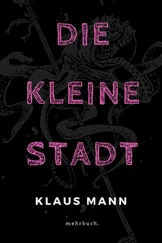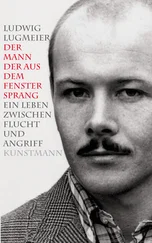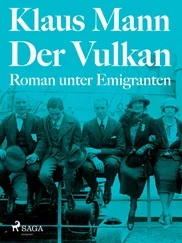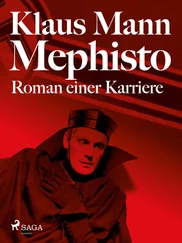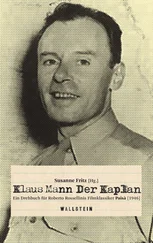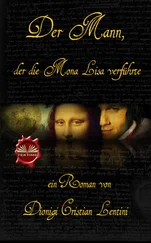Natürlich antworten wir nicht, sondern kichern nur und zucken die Achseln. »Na, was gibt's denn da zu lachen, mein Junge?« Die Urschel, ein wenig pikiert, wendet sich mit ihrer Frage an das größte Kind – nämlich an Erika, die sie, in echt urschelhafter Verblendung, für einen Buben hält. Dies kleine Mißverständnis scheint uns dermaßen ulkig, daß uns gar nichts anderes übrigbleibt, als jubilierend davonzulaufen.
Noch ganz atemlos vor Heiterkeit gesellen wir uns zu unserem Fräulein, das inzwischen, mit einer Kollegin plaudernd, voranspaziert ist. Wir bestürmen sie mit erregten Fragen. Warum will die fremde Urschel wissen, wer unser Vater ist? Und warum nennt sie ihn »Pappi«, wo er doch Zauberer heißt? Und wie, um Gottes willen, kommt sie dazu, uns »niedlich« und »apart« zu finden? Was bedeutet »apart«? Ist es ein Schimpfwort oder das Gegenteil?
»Eher das Gegenteil«, bedeutet uns das Fräulein. »Die Dame wollte nur sagen, daß ihr ein bißchen anders ausseht als die andren Kinder.« Sie prüft uns mit nachdenklichem Blick, um dann, mehr für sich selbst, hinzuzufügen: »Es liegt wohl vor allem am Haarschnitt und überhaupt an der künstlerischen Aufmachung.«
Unsere »künstlerische Aufmachung«, das sind die Leinenkittel mit den hübschen Stickereien aus den Münchener Werkstätten. Mielein hat sie selber ausgesucht, rote Kittel für die Buben, blaue für die Mädchen, wie es sich gehört. Was soll daran nun »apart« sein? Und warum verhöhnen uns die Gassenkinder, wenn wir uns in unseren schmucken Wämsern auf der Straße zeigen, zwei adrette Pärchen (Erika und ich; Golo und Monika), gefolgt von der Gouvernante, beschützt vom hysterisch kreiselnden Schäferhund?
Wie töricht die Fremden sind! Begreifen sie denn nicht, die frechen Buben und verschrobenen Urscheln, daß wir durchaus in Ordnung sind, weder »apart« noch »narrisch«? Zugegeben, Monika ist noch ein bißchen klein und unbeholfen; aber so gehört es sich eben für das jüngste Schwesterchen. Was den Golo betrifft, ein Jahr älter als Monika, so ist er auch nicht viel größer, aber entschieden ernster und gesetzter, fast gravitätisch. Ohne Frage, der Golo ist das Muster und Vorbild eines kleinen Bruders, das Brüderchen par excellence . – Was gibt es da zu lachen? Oder lassen die fremden Toren es sich gar einfallen, die beiden »Großen«, Erika und mich, ridikül zu finden? Das wäre ja noch schöner! Das ahnungslose Pack sollte sich doch lieber der eigenen eklatanten Dummheit schämen, anstatt über uns die Nase zu rümpfen! Denn schließlich, wir sind »echt«, sind »wirklich«, während die Wirklichkeit der anderen problematisch bleibt. Die anderen sind nur »Leute«; wir sind – wir.
Unser Leben ist vorbildlich, comme il faut , da es eben einfach Leben ist, das einzige, das wir kennen. Das Leben bedarf keiner Rechtfertigung, keiner Erklärung. Was bliebe denn übrig von der Welt, wenn es »unsere« Welt nicht gäbe? Ein Nichts, ein Vakuum …
Glücklicherweise können die Fremden uns nichts anhaben mit ihrem Unverstand. Wir brauchen sie nicht; was hätten sie uns zu bieten? Sie sind »affig«, »blöd«, »falsch« und »eingebildet«. Wir kommen ohne sie aus; in unserem eigenen Bereich finden wir alles, was uns wichtig ist. Wir haben unsere eigenen Gesetze und Tabus, unseren Jargon, unsere Lieder, unsere willkürlichen, aber intensiven Vorlieben und Aversionen. Wir genügen uns; wir sind autark.
Die Fanny kocht die Suppe, die Affa deckt den Tisch. Die Fanny ist weniger wichtig als die Affa, aber beide sind unentbehrlich. So auch die dritte Magd, das Hausmädchen. Sie mag noch so häufig kündigen: die kosmische Ordnung sorgt für eine Nachfolgerin, die mit der Vorgängerin fast identisch scheint. Es ist immer das gleiche plumpe Ding vom Lande, aus Passau oder Ingolstadt, die unsere Betten macht. Sie hat große, rote, etwas aufgesprungene Hände, wäßrige, helle Augen und eine niedrige, trotzig gebuckelte Stirn. Ihre wichtigste Funktion in unserem Hauswesen besteht darin, uns Kindern volkstümliche Lieder beizubringen. Ob das Hausmädchen nun Liesbeth heißt oder Therese, ob sie aus Niederbayern stammt oder aus dem Fränkischen, sie ist eine Sängerin und Gesangspädagogin. Von ihr lernen wir all die schönen, rührenden Balladen von verlassenen Bräuten, treulosen Matrosen, gebrochenen Schwüren und Herzen. Wir verstehen nicht ganz, worum es sich eigentlich handelt, aber die Augen werden uns doch naß, wenn wir dem Hausmädchen mit feierlichen Mienen nachsingen: »Mariechen saß weinend im Garten – im Grase lag schlummernd ihr Kind; – mit ihren schwarzbraunen Locken – spielt' leise der Abendwind …« Wie süß und traurig tönt Mariechens Klage! Sie beschwert sich darüber, daß der Liebste nie schreibt. Hat er sie ganz vergessen? Ja, das hat er wohl, und da die Schwarzbraune es sich nun eingesteht, zieht sie auch gleich die einzig logische Konsequenz – kurz entschlossen, ohne übrigens viel Aufhebens davon zu machen. Hinein in den See mit dem Bankert! – Und hinterdrein springt die gelockte Mama.
Wir finden den Schluß etwas jäh, vor allem tut es uns um das Baby leid: was kann das arme kleine Ding dafür, daß der Matrose so vergeßlich ist? Aber dieses etwas irritierende Detail kann uns doch nicht die Freude an dem schönsten Lied verderben. Wir singen es im Chorus, zweistimmig, mit Gefühl.
»Ich verstehe wirklich nicht, warum meine Tochter ihren Kindern erlaubt, so greuliches Zeug zu singen!« Dies ist Offis Stimme: sie ist zum Tee gekommen, nun unterhält sie sich mit dem Kinderfräulein. Das Kinderfräulein, man weiß ja, wie sie sind, ist nur zu entzückt, Offi beipflichten zu können. »Wie recht Frau Geheimrat haben!« ruft sie schrill. »Es ist das Hausmädchen, die Luise, eine ganz ordinäre Person, die gnädige Frau sollte einschreiten, aber auf mich wird hier ja nicht gehört …«
Mielein ist in solchen Fällen geneigt, unsere Partei zu ergreifen. Nicht zu offen natürlich. »Ihr dürft dem Fräulein Betty nicht widersprechen!« ermahnt sie uns etwas vage. »Es kann ja sein, daß sie gerade etwas nervös war. Wahrscheinlich, weil sie sich so viel über euch ärgern muß … Singt uns das Lied doch mal vor, nur, damit wir uns ein Urteil bilden können. Wenn es ein garstiges Lied ist, sollt ihr es nicht mehr singen.«
Mariechen ist ein durchschlagender Erfolg; Mielein und der Zauberer ersticken fast vor Lachen. Endlich bringt der Vater hervor, daß dies, seiner Meinung nach, ein ungewöhnlich rührendes Lied sei; wir sollten es jedoch nicht zu häufig vortragen, teils aus Rücksicht auf Fräulein Bettys Nerven, teils weil die Ballade wirkungsvoller bleiben würde, wenn wir sie für besondere Gelegenheiten aufsparten. Weihnachten wäre vielleicht eine solche Gelegenheit, schlägt einer von uns vor; und die Eltern stimmen lachend bei.
Fräulein Bettys Miene ist säuerlich, um nicht zu sagen bitter, da wir sie von dem elterlichen Entscheid unterrichten.
Das Fräulein kann uns nicht viel anhaben, solange Mielein da ist, um unsere natürlichen Rechte zu schützen. Aber die Lage wurde alarmierend, als die Mutter einen Winter in Davos verbringen mußte, wegen des Hustens und weil sie oft ein bißchen Fieber hatte. Sie schrieb uns drollige und lange Briefe, was es im Sanatorium zu essen gebe, und wie langweilig es für sie sei, jeden Tag so viele Stunden auf dem Balkon zu liegen. Sie schrieb uns, daß sie Sehnsucht nach uns habe und daß wir brav sein sollten. Es waren sehr schöne Briefe, aber doch kein Ersatz für Mieleins Gegenwart. Wenn sie nicht da war, hatten wir niemand, der abends mit uns betete (denn vor dem Fräulein mochten wir unsere Gebete nicht sagen); niemand, der zur Spitze der Hierarchie und zugleich zu uns gehörte, Affa, Fanny, das Hausmädchen, der Motz und wir vier waren schon recht; aber es fehlte uns an Macht und Würde. Der Zauberer und Offi hatten zwar sehr viel Macht; aber letztere erschien doch nur für kurze Inspektionsvisiten, während ersterer, obwohl er mit uns lebte, an unserem alltäglichen Leben kaum Anteil nahm. Wir waren dem Fräulein ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Sie hatte beinah unumschränkte Machtbefugnis; ihre Herrschaft nahm vorübergehend den Charakter einer Diktatur an.
Читать дальше