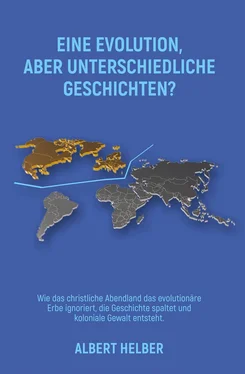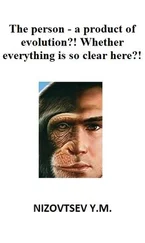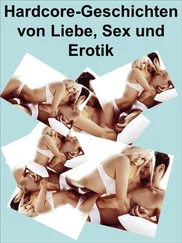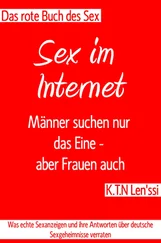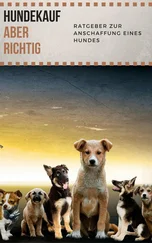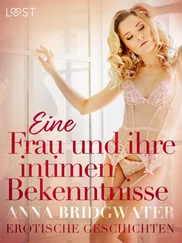—
Lernfähigkeit entsteht im Gehirn durch ein Zusammenspiel von physiko-chemischen Abläufen in den Neuronen, durch eine Verbindung von Neuronen zu neuronalen Netzwerken oder neuronalen Bahnen und schließlich durch ein Zusammenspiel von Hirnstamm und cerebralem Cortex und deren Vermittlung durch ein Zwischenhirn über neuronale Reize, über Hormone und Modulatoren. Im menschlichen Gehirn sind drei strukturelle Ebenen zu unterscheiden. Sie sind in der biologischen Entwicklung nacheinander entstanden, arbeiten zusammen und bewirken gemeinsam eine Lernfähigkeit. Die evolutionär jüngste Struktur ist das thalamo-corticale System und bildet ein dreidimensionales Geflecht aus neuronalen Netzen oder Schaltkreisen, in welchen sensorische Wahrnehmungen bearbeitet und in eine Reaktion oder Aktion verwandelt werden. Die evolutionär älteste Struktur des Gehirns ist der Hirnstamm aus Basalganglien, aus Kleinhirn und Hippocampus, welcher das Großhirn über zentrifugale- oder zentripetale Bahnen mit der Peripherie verbindet und mit der „Zeitmaschine“ Kleinhirn für ein zeitlich adäquates Zusammenspiel von Stimulation und Hemmung sorgt. Zwischen Hirnrinde und Hirnstamm befinden sich in subcortikalen Kernen, im Hypothalamus, im basalen Vorderhirn und in den Amygdala Strukturen des Zwischenhirns, die sowohl neuronale Botschaften an den Körper, aber auch an den cerebralen Cortex geben. Sie produzieren Substanzen, die über die Hypophyse zu Hormonproduzenten werden, aber auch neuromodulatorisch wirksame chemische Reize an den Thalamus und an die Hirnrinde senden, wo schließlich das menschliche Bewusstsein entsteht.
Innerhalb der Hirnrinde reflektieren die Neuronen oder Nervenzellen das bereits angesprochene kosmologische Gesetz von „Reiz und Reaktion“. Der menschliche cerebrale Cortex hat mit etwa 110 Milliarden die höchste Neuronenzahl aller bei Tier und Mensch untersuchten Gehirne und jedes Neuron betreibt zahlreiche Synapsen. Unterschieden werden sensorische-, intermediäre- und motorische Neuronen. Sensorische Neurone nehmen die von Sinnesorganen eingehenden Reize auf und motorische Neuronen geben die Antwort. In allen Gehirnen ist die Zahl der intermediären Neurone höher als die Zahl der sensorischen- oder motorischen Neurone, doch sind sie im menschlichen Gehirn besonders stark vertreten: In Rattengehirnen ist das Verhältnis sensorischer- zu intermediären Neuronen etwa 1:20, im menschlichen Gehirn ist ihr Verhältnis 1: 20 000 31. In den intermediären Neuronen werden sinnliche Wahrnehmungen mit Erinnerungen, mit Gefühlen oder Gedanken verglichen und so eine neue Antwort erarbeitet. Neue Gefühle und Gedanken entstehen, die sich wiederum an sinnlichen Wahrnehmungen, am Umfeld oder am Mitmenschen orientieren. Andererseits entwickelt der Mensch auch Phantasien und Illusionen, die keinen Bezug zu sinnlichen Erfahrungen haben, weltabgewandte Abstraktionen sind und zu Ideologien oder Religionen werden. Diese Abstraktionen, Ideologien oder Religionen sind wohl das Produkt intermediärer Neurone, welche einen Bezug zu sensorischen Neuronen eingebüßt haben.
—
Tierische- und menschliche Lernfähigkeit entsteht im Gehirn durch ein „implizites Kurzzeitgedächtnis“ als Voraussetzung des Lernens. Einzelne Neurone oder neuronale Verbindungen können gebahnt werden und unterschiedlich schnell ihren Informationsauftrag erfüllen.Wie Lernen funktioniert entnehme ich Eric Kandels Buch „Suche nach dem Gedächtnis“ 28. Für die bahnbrechenden Untersuchungen seiner Arbeitsgruppe erhielt Eric Kandel im Jahre 2000 den Nobelpreis für Physiologie. Kandel unterscheidet ein in der biologischen Evolution früh entstandenes-, primäres- oder „implizites Gedächtnis“ oder Kurzzeitgedächtnis, von einem evolutionär jüngeren-, sekundären- oder „explizitem Langzeitgedächtnis“. Erinnern, eine Funktion des „impliziten Kurzzeitgedächtnisses“ ist für Kandel eine Voraussetzung des Lernens. V.a. aber ist dieses implizite Kurzzeitgedächtnis eine strukturelle Eigenschaft aller neuronalen Verbindungen oder Netzwerke. Wo immer Synapsen Neurone verbinden kann deren Funktion gestärkt oder geschwächt-, stimuliert oder inhibiert werden. Eine in allen Neuronen gleiche Übertragung würde kein Gedächtnis schaffen und auch kein Lernen ermöglichen. Erst die Bereitstellung von aktivierenden Substanzen an der Synapse, von modulierenden Transmittern oder elektrischen Reizen und unterschiedliches Verhalten von Rezeptoren schafft neuronale Netze, die selektiv begehbar werden und eventuelle Reize entweder schnell oder langsam verarbeiten. Schnelle Netze führen zur Bahnung von Aktivitäten, zu Assoziationen und Automatismen, zu funktionalen Algorithmen. Sie entstehen bei Wiederholungen und beim Üben. Wer lernt und übt, wird jene neuronalen Bahnen aktivieren, deren schnelles Zusammenwirken Assoziationen und Automatismen schafft, die schließlich den Lernerfolg bestimmen. Mit biophysikalisch wirksamen Strukturen werden in unserem Zentralnervensystem Zusammenhänge erarbeitet, die etwas Neues an Stelle des bisher Gegebenen erschaffen. Das Neue ist etwas Erlerntes und ist durch ein „implizites Gedächtnis“, durch unterschiedliche Aktivitäten in unseren neuronalen Netzen durch assoziierendes Bahnen entstanden.
Die Bahnung neuronaler Netze lenkt das motorische Lernen des Menschen. Wer Bewegungen übt, induziert in den für diese Bewegung zuständigen neuronalen Netzen anatomische Veränderungen. Synapsen werden prominenter und neue Netze entstehen. Es sind mikroskopisch nachweisbare, erworbene Eigenschaften, die aber genetisch nicht übertragbar sind. Die von Kandel beschriebenen neuronalen und das Lernen ermöglichenden Strukturen wurden auf dem langen Weg der Evolution erschaffen. Im Genom wurde festgelegt, welche Funktionen der Anpassung an das Umfeld genügen. Im Genom wird entschieden, wie wir zu aufrechten Menschen werden. Wozu die Evolution 6-12 Millionen Jahre benötigte, schaffen wir durch Übung und Lernen in etwa einem Jahr, weil wir die von der Evolution entwickelte Lernfähigkeit benutzen können. Zum Zeitpunkt unserer Geburt sind die Voraussetzungen für eine Anpassung ans Umfeld noch nicht gegeben. Wir müssen erst noch lernen auf zwei Beinen zu gehen. Die von der Evolution geschaffene „motorische Intelligenz“ des Lernens hilft uns, durch regelmäßiges Versuchen und Üben jenen Automatismus zu erwerben, der uns schließlich aufrechte Stabilität verleiht: Jede Muskelaktion arbeitet nach dem Prinzip der „reziproken Hemmung“. Jede Muskelaktion der Strecker erfordert eine zeitlich präzise Inaktivierung der entspannenden Partner. Verantwortlich für dieses muskuläre Zusammenspiel ist eine durch die o.g. Bahnung entstandene motorische Intelligenz, die in Basalganglien des Stammhirns und mit der „Zeitmaschine“ Kleinhirn jene Strukturen schuf, die das Erlernen eines aufrechten Ganges in unserem ersten Lebensjahr möglich machte.
Was ich am Beispiel des aufrechten Ganges im ersten Lebensjahr zu beschreiben versuche, ist ein Entwicklungsphänomen, an welchem sich die Plastizität des menschlichen Gehirnsdemonstrieren lässt. Korrekte Bewegungen entstehen nur durch Übung und Lernen und unser Gehirn macht Lernen möglich. Physiologie und Medizin kennen in der Zwischenzeit zahlreiche Beispiele für eine funktionelle Plastizität des Gehirns, indem sich dessen Neurone nach „funktionalen- und aktivitätsabhängigen“ Kriterien vernetzen: Bei Klaviervirtuosen wird die Repräsentation der Finger durch regelmäßigen Gebrauch im motorischen Cortex unseres Gehirns umfangreicher. Der Zuwachs ist Resultat des Lernens durch Wiederholung und macht das Erlernte durch Bahnung der dafür zuständigen Neurone zur Routine. Die Evolution hat uns die Möglichkeit des Lernens geschenkt. Was aber erlernt werden soll muss angestrebt und geübt werden. Nach Schlaganfällen mit Zerstörung unterschiedlicher Hirnareale können Behinderungen der Beweglichkeit oder Sprachausfälle auftreten. Das „selbstreferentielle System Gehirn“ 32arbeitet „autopoietisch“, selbstorganisierend und offenbart Plastizität. Solange unbeschädigte Neurone noch in Kontakt zu sensorischen Einflüssen stehen, durch die üblicherweise Bewegungen oder Sprache ausgelöst werden, können diese die ausgefallenen Funktionen der Bewegung oder der Sprache zum Teil übernehmen. Die Übungsintensität entscheidet über den Erfolg einer Rehabilitation.
Читать дальше