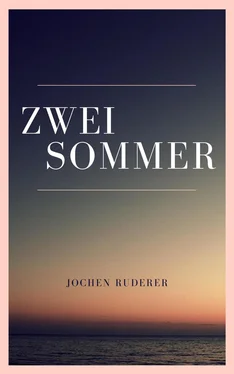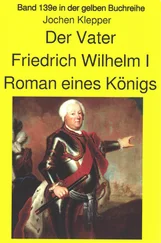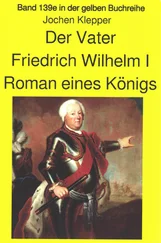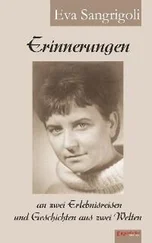„Dreh dich nicht um. Hau endlich ab!“ Aus den Augenwinkeln glaubte Mensur zu sehen, dass sich zwei Soldaten mit ihren Gewehren in seine Richtung drehten und dann begann es. „Es ist passiert – einfach von selbst“ sagte er zu mir. Nach den ersten fünf Schritten machte er einen überraschenden Sprung nach links. Im gleichen Moment meinte er zu fühlen, wie eine Kugel direkt rechts neben ihm vorbei pfiff. Sie schienen also tatsächlich auf ihn zu schießen. Allerdings hütete sich der Hase, noch einmal zurückzublicken. Er lief weiter, so schnell er irgendwie konnte. Und während er das Wäldchen vor sich fest ins Visier nahm, hüpfte er von links nach rechts, duckte sich urplötzlich, rollte sich ab, schlug Haken und rannte, rannte, rannte. Immer wieder glaubte er, Schüsse zu hören. Jedes Mal rechnete er fest damit, dass ihm ein Projektil den Rücken aufreißen und ihn in den Matsch schleudern würde. Die Angst machte ihn fast wahnsinnig. Und dann, so erzählte er es mir, hörte er von einem Moment auf den anderen auf, überhaupt zu denken. Er dachte nicht mehr darüber nach, wo er war und was er hier tat. Er vergaß, was vor einigen Minuten geschehen war und was mit ihm jeden Moment geschehen könnte. Sein Gehirn gab das letzte bisschen Kontrolle ab und seine Beine übernahmen: er sprang, krabbelte, änderte die Richtung und kam immer weiter fort. Das einzige, was er noch wahrnahm war, das Keuchen seiner Atemzüge und das schmerzhafte Pochen seines Herzens. Es raste in seiner Brust, wie eine Nähmaschine, wild entschlossen, sich nicht von einem Stück Metall auseinanderreißen zu lassen. „Herz war laut - aber Herz war ruhig“, so formulierte es der Hase mir gegenüber. „Und da, ich wusste, ich werde schaffen.“
Mensur erreichte den schützenden Wald ohne einen Kratzer. „Weil ich gelaufen bin wie Hase“, erzählte er mir voller Stolz. Seit diesem Tag hatte er nicht mehr damit aufgehört. Aber nicht, weil er nicht konnte, wie er mir versicherte – er wollte nicht. Das Hakenschlagen hatte ihm das Leben gerettet und vielleicht würde es das wieder tun. Vielleicht würde ihn sonst ein herabstürzender Blumentopf treffen oder ein Auto, das außer Kontrolle geraten war, sagte er. Ein Stein, den irgendjemand in Wut geschleudert hatte oder eben doch eine Patrone seiner Verfolger, die ihn nach all den Jahren aufgespürt hatten. „Herz schlägt immer noch“, beschloss er seine Geschichte mit einem Lächeln und der Hand auf der Brust. „Immer noch so, wie diese Tag“. Ich erwiderte sein Lächeln, um ihm zu zeigen, dass ich ihn verstand. Aber ich schien ihn nicht zu überzeugen. Wie um mich zu beruhigen, legte er die Hand auf meinen Unterarm und sagte in beschwichtigendem Ton erneut: „Ich nicht verrückt.“
Und ich eben auch nicht. Ich weiß sehr gut, dass Ihnen mein Verhalten sonderbar erscheint. So sonderbar, dass Sie mir geraten haben, erstmal hier zu bleiben. So sonderbar, wie mir das Gehüpfe des Hasen erschien, bevor er mir seine Geschichte erzählte. Also möchte ich Ihnen meine Geschichte erzählen, auch wenn ich dafür ein wenig mehr Zeit benötigen werde als der Hase. Aber lassen Sie mich diese beiden Dinge vorausschicken: Erstens, ich bin nicht verrückt. Zweitens, ich verstehe und akzeptiere, dass Sie Gründe haben, das anders zu sehen. Aber Sie irren sich.
Am Morgen des 3. November 1978 erwachte mein Vater, Herbert Josef Boltenhagen, bei bester Gesundheit und Laune. Er trank seine übliche Tasse Ostfriesentee, aß zwei Scheiben Graubrot mit Käse, küsste seine Frau und seinen neun Monate alten Sohn zärtlich auf die Stirn, verließ pünktlich um 8:30 Uhr die frisch eingerichtete Vierzimmerwohnung und kam nie wieder nach Hause. Arbeitsunfall. Dabei hatte er einen geradezu lächerlich ungefährlichen Beruf. Er war Pianist des örtlichen Konzerthauses – in Festanstellung, wie meine Mutter niemals hinzuzufügen vergaß. „Er war das jüngste Mitglied des gesamten Ensembles und das bei einem so seltenen Posten“.
Das Schlimmste, was einem Pianisten bei der Arbeit gewöhnlicherweise zustoßen kann, ist, dass ein vermeintlicher Kunstkenner, von einem schiefen Ton bis aufs Blut gereizt, sich zum Äußersten genötigt sieht und die halb aufgekaute Pausenbrezel in den Orchestergraben pfeffert. Aber mein Vater begnügte sich nicht mit dem Gewöhnlichen.
Meine Mutter erzählte immer, es geschah pünktlich zum Ende der nachmittäglichen Probe – auch dieses Detail scheint ihr wichtig. Als ob mein Vater noch im Tod ein besonderes Pflichtbewusstsein an den Tag gelegt hätte, indem er erst nach der Probe das Zeitliche segnete. Jedenfalls vernahmen die übrigen Orchestermitglieder unvermittelt einen lauten Knall. Und dort, wo Momente zuvor mein Vater seine ganze Hingabe und all das überbordende Talent seiner achtundzwanzig Lebensjahre in die Tasten eines Bösendorfer-Konzertflügels gehauen hatte, lag nun ein etwa fünfzehn Kilo schwerer Bühnenscheinwerfer. Niemand konnte wirklich verstehen, woher und wieso und warum gerade jetzt. Eine eilig angesetzte Überprüfung am Nachmittag bescheinigte dem Betreiber des Hauses, dass die Anlage ordnungsgemäß gewartet wurde und ermittelte als Ursache Materialermüdung. Bis auf die Bruchstelle, so steht es in dem Bericht, habe sich die Anlage in einwandfreiem Zustand befunden . Alles bestens also. Niemand war schuld. Ich weiß nicht, ob diese Aussage den angeblich großen Ordnungssinn meines Vaters befriedigt hätte – für seinen Schädel war sie wenig tröstlich. Er verlor den Kampf gegen die unnachgiebigen Gesetzmäßigkeiten der Physik eine knappe halbe Stunde nach dem Aufprall, als man ihn gerade auf den OP-Tisch des örtlichen Krankenhauses heben wollte.
Meine Mutter erzählte mir die Geschichte vom Tod meines Vaters schon, als ich noch sehr klein war. Wahrscheinlich ist es sogar die erste Geschichte, die ich bewusst hörte. In meinem Kopf steht sie in einer Reihe mit den anderen Erzählungen meiner Kindheit. Märchen von Kindern, die von ihren Eltern im Wald ausgesetzt werden. Geschichten von Königinnen, die nach der Geburt ihrer Tochter sterben, um schon im nächsten Satz von einer jüngeren, schöneren Frau ersetzt zu werden. Und dazu eben der Bericht von dem talentierten jungen Musiker, der so unglücklich und sinnlos zu Tode kommt. Erst mit dreizehn oder vierzehn begriff ich wirklich, dass diese Geschichte von dem Mann handelte, der mich gezeugt, monatelang freudig auf mich gewartet und mir als Baby stundenlang Lieder vorgesungen hatte. Und erst als ich mit Mitte zwanzig zum ersten Mal von der Materialermüdung las, empfand ich so etwas wie Wut und Verzweiflung über mein eigenes Unglück. Meine gesamte Kindheit hindurch jedoch blieb der Tod meines Vaters nicht mehr als eine Geschichte.
Verstehen Sie mich nicht falsch - natürlich konnte ich die Tragik eines so frühen Todes mit meinem Verstand erfassen. Die Geschichte an sich fand ich sehr traurig und es tat mir leid für die Frau und das Kind. Und natürlich wusste ich, dass ich dieses Kind war - aber es gelang mir nicht, diese Geschichte als persönlichen Schicksalsschlag zu empfinden . Es war einfach meine Geschichte. „Mein Vater wurde von einem herabstürzenden Scheinwerfer erschlagen, als ich noch ein Baby war“. Das ging mir vergleichsweise leicht über die Lippen. Oder einfacher: „Mein Vater ist schon lange tot.“ Die traurigen und mitleidigen Blicke, die ich daraufhin erntete, waren mir meist unangenehm. Ich wurde dann still und blickte zu Boden und irgendwie waren alle mit dieser Reaktion einverstanden. Ich selbst fühlte mich dabei wie ein schlechter Schauspieler, wie ein Betrüger. Den traurigen Jungen, den alle mitleidig anblickten, spielte ich nur vor, weil man es von mir erwartete. Aber es gelang mir nie, diese Trauer auch zu empfinden. Andere Väter waren Säufer oder Schläger. Mein Vater war tot. Es gab Schlimmeres.
Читать дальше