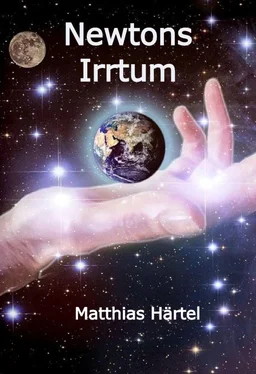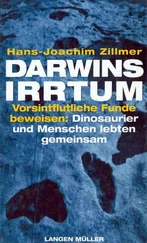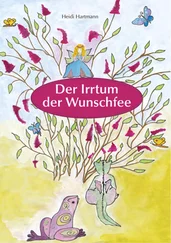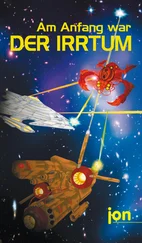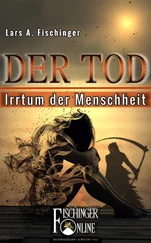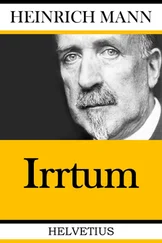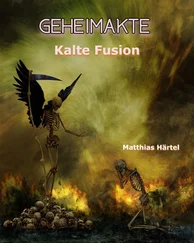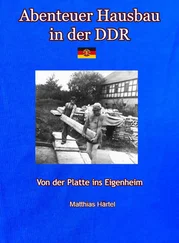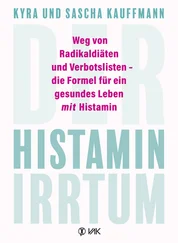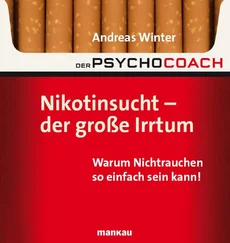Nun, keine Angst, das sollte nur ein kleiner Spaß sein, um die Atmosphäre ein bisschen aufzulockern.
Womit wir uns nun, langsam aber sicher, an das Kernproblem, des Pudels Kern gewissermaßen, heranbegeben wollen.
Aber wo anfangen?
Am besten wir bleiben gleich bei der Fliehkraft, die eben nun mal auch noch existiert und somit dieses unbequeme Davonfliegen verursacht.
Die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, liegen klar auf der Hand, sind aber entsprechend der nunmehr ereichten Problemstellung nicht mehr so einfach zu beantworten, da nun verschiedenen Elemente mit ins Spiel kommen werden.
Hier nun also die Fragen:
Wieso fliegt bei einer kleinen Kugel, die in Drehung versetzt wird, das was sich lose auf der Oberfläche befindet, davon?
Wieso passiert das Selbe - ersichtlich - auf unserer Erde eben nicht?
Gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man sich die oben auf-geführte Definition für die Gravitation vor Augen hält, nicht wahr?
Also, wenn die Gravitation als nach innen gerichtete Sogkraft tatsächlich so existiert, so muß eigentlich diese Kraft bei jedem sich drehenden kugelförmigen Körper auftreten und sie müsste trotz ihrer angeblichen Schwäche stärker sein, als die ebenfalls auftretende Fliehkraft.
Immer getreu dem alten Sprichwort, das da lautet:
Wie im Großen, so auch im Kleinen (und umgekehrt)!
Könnte man jedenfalls meinen, wenn man sich die Gegebenheiten unserer Erde so vor Augen führt, denn auf Erden fliegt ja nichts davon, sondern es bleibt alles hübsch an Ort und Stelle.
Nun ja, könnte man sagen, vielleicht spielt hier ja doch die Größe und die Masse eine entscheidende Rolle?
Oder halt, unsere kleine Kugel, die als Modell dienen soll, befindet sich ja eben auch auf der Erde und ist somit wohl anderen Gesetz-mäßigkeiten unterworfen, als eben die Erde selbst?
Die kleine Kugel befindet sich ja direkt auf der Erdoberfläche, in der Lufthülle unserer Erde, während sich die Erde selbst ja im Weltraum, also in einem Vakuum befindet.
Sehr viele Einwände, die durchaus zu beachten sind, wie man un-schwer erkennen kann.
Also spinnen wir getrost den Faden weiter, wobei sich nun natürlich gleich wieder weitere Fragen ergeben werden.
Aber das ist ja gerade das Schöne daran!
Warum funktioniert also die Gravitation bei unserer kleinen Kugel nicht so, wie dies anscheinend bei unserer Erde der Fall ist?
Warum gibt es hier solch eklatante Unterschiede?
Genau hier liegt der Hase wohl im Pfeffer, wie man so schön sagt, denn es ist mir wirklich nicht ersichtlich, warum die Gravitation, die ja wohl ein Naturgesetz sein muß, nicht bei beiden Kugeln in gleicher Art und Weise funktioniert?
Wo ist hier wohl der Haken, beziehungsweise die Lösung des Übels zu finden?
Also gehen wir es erneut an. Das auf unserer Erde die Fliehkraft vorhanden ist, muß man nicht erst verdeutlichen, denn jeder von uns hat diese wohl schon einmal am eigenen Leibe zu spüren bekommen.
Diese Fliehkraft ist nun auch entsprechend stark, aber wohl doch nicht so stark, dass sie der Gravitation entgegenwirken könnte. Wäre dies nämlich der Fall, so würde uns die Fliehkraft sonst wohin katapultieren, was also letztendlich nur bedeuten kann, dass die angeblich so schwache Gravitation doch bedeutend stärker ist als die Fliehkraft und ihr somit entgegenwirkt.
Klingt zumindest einleuchtend, oder?
Wieso funktioniert das aber nun bei einer kleinen Kugel nicht?
Nun, es kann eigentlich nur daran liegen, dass sich die kleine Kugel nicht im Weltraum, also einem Vakuum, befindet!
Stimmt das so?
Gute Frage, denn ich weis nicht, ob man schon einmal entsprechende Experimente auf der ISS gemacht hat?
Da die Gegebenheiten auf unserer Erde aber nun mal so sind, wie sie sind, muß man eigentlich davon ausgehen, dass das Vakuum hier eine wichtige Rolle spielen muß!
Nur was für eine, ist hier die nächste Frage, denn es ist letztendlich auch nicht ersichtlich, was eigentlich die Ursache für die postulierte Sogkraft, die man auch Erdanziehung nennt, ist?
Womit wir beim nächsten Problem angelangt wären, denn wie entsteht denn diese Sog-/Anziehungskraft auf unserer Erde?
Durch die Drehung, könnte man sagen!
Aber ist das nun wieder richtig?
Denn eine Drehung erzeugt doch immer eine Kraft, die nach außen strebt, aber doch wohl niemals eine Kraft die nach innen strebt.
Womit wir uns nun anfangen, in einem Kreis zu drehen, wie Sie nun wohl auch sicher schon bemerkt haben, denn irgendetwas stimmt hier wohl nicht mit der postulierten Sog-/Anziehungskraft, da es diese bei einer sich drehenden Kugel nun mal nicht gibt!
Irgendetwas wurde da wohl falsch interpretiert oder auch ganz einfach falsch verstanden, weshalb wir uns nun doch kurz mit dem Mann befassen müssen, der sozusagen als Vater der Gravitation gelten kann.
Isaac Newton
Greifen wir also noch einmal kurz auf Wikipedia zurück und sehen uns an, was hier über den Gelehrten so vermerkt ist.
„Sir Isaac Newton (nach Gregorianischem Kalender: * 4. Januar 1643 in Woolsthorpe-by-Colsterworth in Lincolnshire; † 31. März 1727 in Kensington – nach dem damals in England noch geltenden Julianischen Kalender: * 25. Dezember 1642; † 20. März 1727) war ein englischer Physiker, Mathematiker, Astronom, Alchemist, Philosoph und Theologe.
In der Sprache seiner Zeit, die zwischen Physik und Philosophie noch nicht scharf trennte, wurde Newton als Philosoph bezeichnet.
Sir Isaac Newton ist der Verfasser der Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, wo er die universelle Gravitation und die Bewegungsgesetze beschrieb und damit den Grundstein für die klassische Mechanik legte. Newton ist ebenso einer der Begründer der Infinitesimalrechnung, die er fast zeitgleich mit Gottfried Wilhelm Leibniz, aber unabhängig von diesem und ohne Zusammenarbeit mit Leibniz entwickelte. Während Newton vom physikalischen Prinzip der Momentangeschwindigkeit ausging, versuchte Leibniz eine mathematische Beschreibung des geometrischen Tangentenproblems zu finden.
Aufgrund seiner Leistungen, vor allem auf den Gebieten der Physik und Mathematik, gilt Sir Isaac Newton als einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten. Die Principia Mathematica werden als eines der wichtigsten wissenschaftlichen Werke eingestuft.
Leben und Werk
Newtons Vater, ein Landwirt, starb vor der Geburt seines Sohnes. 1646 heiratete seine Mutter zum zweiten Mal und Isaac kam zu seiner Großmutter. Bald darauf starb auch sein Stiefvater, so dass Isaac nach Woolsthorpe zurückkehrte. Er besuchte die Grundschule in Grantham und mit 18 Jahren das Trinity College in Cambridge, das kurz nach dem Abschluss seines Studiums 1665 wegen der Großen Pest geschlossen werden musste. Also kehrte er abermals zurück in sein Elternhaus.
1666 stellte er seine Gravitationstheorie auf. Er schliff Linsen und baute ein später nach ihm benanntes Spiegelteleskop, das er dem König vorführte, der beeindruckt war. Das war der erste Schritt zu seinem Ruhm. In einem Brief an die Royal Society erwähnte Newton im Zusammenhang mit dem Bau des neuartigen Teleskops gegenüber dem damaligen Sekretär Henry Oldenburg eine neue Theorie des Lichtes. 1672 veröffentlichte er seine Niederschrift "New Theory about Light and Colours" in den Philosphical Transactions der Royal Society auf Anfrage Oldenburgs, worin er unter anderem die Brechung des Lichts erläuterte. Diese Niederschrift rief große Diskussionen hervor. Besonders zwischen ihm und Robert Hooke herrschte ein angespanntes Verhältnis, da beide angesehene Wissenschaftler waren, doch grundverschiedene Meinungen hatten und jeder auf sein Recht pochte.
In den "New Theory about Light and Colours" vertrat Newton die Korpuskeltheorie des Lichts, bei der er von einem Teilchenmodell ausging. Im Gegensatz zu René Descartes ging Newton jedoch davon aus, dass die Farben ursprüngliche Eigenschaften des Lichtes sind. Außerdem führte dies zu einem wiederum erbittert ausgetragenen Disput mit Christiaan Huygens und dessen Wellentheorie des Lichtes, welchen er 1715 durch Desaguliers vor der Royal Society für sich entscheiden ließ. Nachdem Thomas Young im Jahre 1800, lange nach beider Tod, weitere Experimente zu Bestätigung der Wellentheorie durchführte, sind heute beide Theorien in der Quantenmechanik mathematisch vereint.
Читать дальше