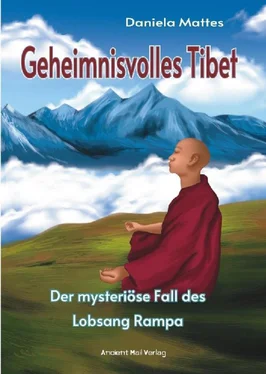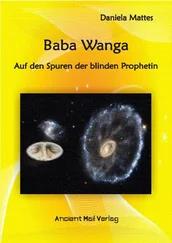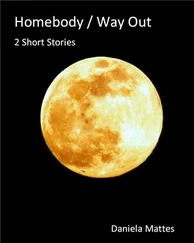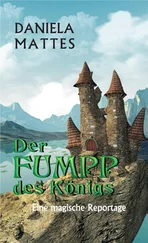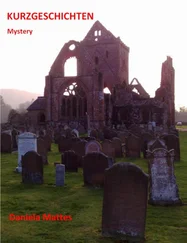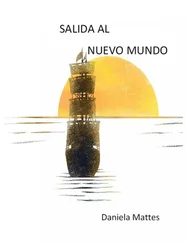In dem Bericht wurde auch seine Adoptivtochter Sheelagh Rouse zitiert, die sich nach der Trennung von ihrem Mann bei dem Lama und seiner Frau aufhielt: „Jemand hat einen Privatdetektiv engagiert, um den Lama zu diskreditieren und mich zurückzugewinnen, aber es gibt keine Hoffnung auf eine Versöhnung mit meinem Mann. Es ist alles vorbei. Nichts wird mich dazu bringen, den Lama zu verlassen. Hier habe ich endlich meinen Frieden gefunden.“
Auch nach den ganzen Enthüllungen lautete das allgemeine Urteil seiner Leserschaft jedoch, dass die Geschichte in dem Buch gut geschrieben und fesselnd war. Daran konnte auch die wahre Identität des Lamas nichts ändern. Diese Faszination hatte auch der Verleger empfunden, wie die Presse berichtet, sonst hätte er das Buch gar nicht herausgebracht.
Allerdings mehrten sich seine Zweifel, nachdem sich Experten kritisch über das Werk geäußert hatten. Besonders Tibeter glaubten die Geschichte ganz oder zumindest teilweise nicht. Als die Zweifel „überwältigend“ wurden, wie der Verleger sagte, beschuldigte er den Lama ein Schwindler zu sein. Doch dieser wehrte sich energisch und beharrte darauf, dass die Geschichte echt sei. Lediglich hätte er seine tibetischen Sprachkenntnisse (in Schrift und Wort) während der japanischen Gefangenschaft durch Hypnose blockiert. Danach hätte er „seine Muttersprache nie wieder vollständig beherrscht.“
Der Verleger stand nur vor einem Problem. Denn die Leute liebten die lebendigen und anschaulichen Erlebnisse des Lamas, die im Buch geschildert wurden. Und nicht alle Informationen darin waren erfunden. Das Buch wurde künftig mit einem entsprechenden Verweis gedruckt, dass der Leser sich eine eigene Meinung darüber bilden sollte, ob die Geschichte wahr oder falsch sei.
Doch die Frage blieb: wie konnte ein Cyril Henry Hoskin (oder Dr. Kuan) ein derartig spannendes Buch schreiben? Woher hatte er die Informationen und die schriftstellerischen Fähigkeiten? Und wieso hatte er gerade dieses Thema gewählt?
Die Fragen konnte der Verleger leider nicht klären und sein Autor bestand darauf, dass jedes Wort im Buch wahr sei. Dennoch stand er hinter ihm: „Auch wenn wir unsere Streitigkeiten hatten, mag ich ihn. Ich bewundere seine Tapferkeit. Es ist keine Kleinigkeit, die Welt 15 Monate lang getäuscht zu haben. Als Autor finde ich ihn erstklassig, und kein Verleger kann ein größeres Lob aussprechen.“
Swāmī Agehānanda Bhāratī
Dieser Professor für Anthropologie ist eigentlich ein Österreicher namens Leopold Fischer (1923 – 1991), der unter den Experten war, die Rampas Buchmanuskript beurteilen sollten. Auch Fischer alias Agehananda Bharati kritisiert „Das dritte Auge“ und Rampa als Person nicht gerade zimperlich.
Agehananda Bharati bezeichnet die von Cyril Hoskin alias Lobsang Rampa ausgelöste „Bewegung“ als den „Rampaismus“. In seinem Artikel „Das fiktive Tibet: Der Ursprung und das Fortbestehen des Rampaismus“ erklärt er, dass viele Schriftsteller und Redner kurz vor der Jahrhundertwende dazu beigetragen haben, Geschichten über tibetische Mystiker in ihren esoterischen Schriften zu verbreiten.
Aber der Höhepunkt dieser Sache war Lobsang Rampas „Das dritte Auge“ und dessen weitere Werke zum selben Thema. Bharati bezeichnet die Werke offen als betrügerisch und findet die Menge seiner Fans „deprimierend“, die offenbar uninformiert und auch „uninformierbar“ sind und daran festhalten, dass es im Himalaya eine versteckte mysti-sche Bruderschaft gibt, die alle Mysterien der Welt kennen und „die Lehren des Buddhismus, Hinduismus und Christentums in sich vereinen und transzendieren“ und die „auch alle okkulten Künste beherrschen“. Denn sie können extrem schnell durch die Luft fliegen, Strecken von 400 Meilen ohne Pause an einem Stück laufen, überall auftauchen und sie sind außerdem die Hauptberater aller Weisen und Großen. Dazu kommt, dass sie all ihre bisherigen Inkarnationen kennen und auch allen anderen Menschen darüber Auskunft erteilen können, wer sie in ihren früheren Leben waren oder in ihren nächsten Leben sein werden.
Bharati ist also offenbar nicht von den Fähigkeiten der Mönche überzeugt, zumindest nicht von denen, die Rampa in seinen Werken beschreibt. Aber er hat auch ein Problem mit der Geografie des fiktiven Tibets. Denn Rampas Tibet und Himalaya schließt oft auch Indien und den Ganges mit ein. Insofern entbehrt die geografische Beschreibung einer gewissen Genauigkeit und lässt sich schwer nachprüfen.
Im weiteren Verlauf seiner Kritik macht Bharati zunächst einen Rundumschlag und bezichtigt die berühmten Theosophen Helena Blavatsky und Oberst Olcott (die ebenfalls über das mystische Tibet berichten) als Betrüger. Dann kommt er konkret auf Hoskins „Rampaismus“ zu sprechen, der am Ende dieser „Faszination Tibet“-Entwicklung steht.
Bharati war einer der Experten, der Rampas Manuskript vom Verlag zur Prüfung und Stellungnahme erhalten hatte. Er beschreibt, dass er sofort skeptisch war, als er den Titel sah, da „Das dritte Auge“ ihn unmittelbar an Blavatskys „Mumpitz“ erinnerte. Sein Urteil fällt hart aus: „Die ersten zwei Seiten überzeugten mich davon, dass der Autor kein Tibeter war, die nächsten zehn, dass er nie in Tibet oder Indien gewesen ist und dass er absolut nichts über den Buddhismus (den tibetischen oder einen anderen) wusste.“
Das macht er vor allem an dem Satz „Denn wir wissen dass es einen Gott gibt“ fest, den Rampa in seinem Werk äußert. Laut Bharati würde dieser Satz einem echten Buddhisten nie über die Lippen kommen, da es nicht dem Kern des Buddhismus entspricht. Aber er findet noch viele weitere Beispiele dafür, dass Lobsang Rampa nicht weiß wovon er schreibt: „Jede Seite zeugt von der völligen Unkenntnis des Autors von allem, was mit dem Buddhismus zu tun hat, wie er praktiziert wird und mit dem Buddhismus als Glaubenssystem in Tibet oder anderswo.“
Er weist aber auch darauf hin, dass Rampa den Geschmack der Massen befriedigen kann mit den mysteriösen Geschichten über Mönchen, die Drachen fliegen und chirurgische Eingriffe, die das dritte Auge öffnen können. Die Menschen im Westen lieben diese Dinge! Sogar Leser, die diese Dinge nicht glauben, sondern zum Vergnügen lesen, beäugt Bharati kritisch. Er findet es nicht gut, wenn die Menschen ihren Trost oder ihre Inspiration aus erfundenen Geschichten ziehen. Denn „esoterisches Wissen kann nicht aus esoterischen Lügen gewonnen werden.“
Bharati weiß auch von anderen Tibetologen wie Hugh Richardson, Marco Pallis oder Heinrich Harrer, die ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen sind, „dass das Buch ein Betrug und der Mann ein Schwindler ist.“ Trotzdem ist das Buch erschienen, denn, wie Bharati sagt, „Verlage sind nicht die Vorboten der Authentizität, sondern Geschäftsleute.“ Und hier hatten sie auch den richtigen Riecher, denn das Buch verkaufte sich, wie wir wissen, schnell und in großen Mengen.
Bharati weist auch darauf hin, dass nach Rampas Entlarvung klar war, dass es sich um einen Mr. Hoskin handelte, „einen irischen ex-Klempner, der in verschiedenen Londoner Bibliotheken gesessen hatte und dort Science-Fiction, Pseudo-Orientalisches, zweifellos inklusive Blavatsky, gelesen hatte und sich dann dieses erstaunliche Buch ausdachte.“
Überrascht war Bharati allerdings dann doch davon, dass die Enthüllung anscheinend seine Anhänger und Fans überhaupt nicht zu beeindrucken schien. Entweder, weil sie in der Zeitung nicht davon gelesen hatten oder weil es ihnen egal war. Außerdem berichtet er auch, dass er Anrufe von Fans erhielt, die ihn als einen bösen Menschen be-schimpften, da Rampa „vielleicht den Körper eines irischen Klempners besitze, aber die Seele eines tibetischen Lamas in ihm wohne“.
Читать дальше