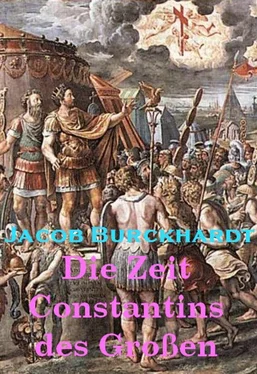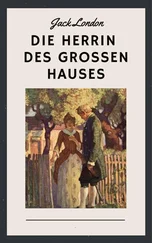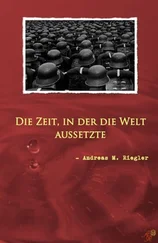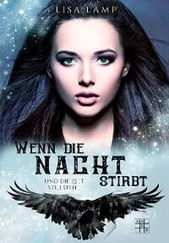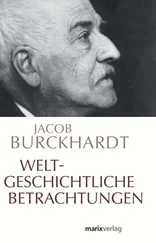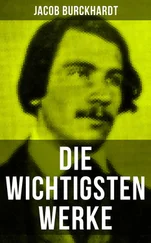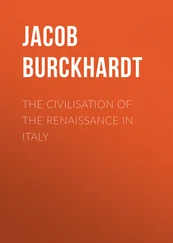In den verödeten, nördlichen und östlichen Teilen Galliens musste man wohl oder übel in dem seit Claudius und Probus begonnenen System fortfahren und die kriegsgefangenen Germanen als Ackerknechte, teilweise aber auch als freie Bauern, ja als Grenzwächter ansiedeln. Die Lobredner Panegyr. V (Eumen. Constantio, vom J. 297) und VII (Constantino, vom J. 310), passim. Vgl. Hist. Aug., Probus 15. rühmen es, wie alle Markthallen voll Gefangener sitzen, welche ihr Schicksal erwarten; wie der Chamave, der Friese – einst so leichtfüssige Räuber – jetzt im Schweiss ihres Angesichtes das Feld bauen und die Märkte mit Vieh und Korn besuchen; wie sie sich auch der Aushebung und der römischen Kriegszucht unterwerfen müssen; wie Constantius die Franken von den fernsten Gestaden des Barbarenlandes hergeholt, um sie in den Einöden Galliens Nachweisbar z. B.: in den Vogesen, wo es noch im Mittelalter einen Chamavengau und einen Chattuariergau gegeben hat. Vgl. für die ganze Völkerwanderung: Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, und Wietersheim, Gesch. der Völkerwanderung. zum Ackerbau und Kriegsdienst zu erziehen, u. dgl. m. – tatsächlich waren es doch lauter Experimente der Not, und zwar sehr gefährliche, tatsächlich war das nördliche Gallien bereits halb germanisch geworden. Sobald die Stammesgenossen dieser Gefangenen wieder in Gallien einbrachen, konnten sie in den letztern lauter Verbündete finden, wenn nicht eine geraume Zeit dazwischen verstrichen war.
Diese Eventualität einstweilen abzuhalten, gelang dem Glück, dem Talente und der Grausamkeit Constantins, als er in dem ersten Jahre nach seines Vaters Tode (306) den Bund einiger Frankenvölker zu bekämpfen hatte, welche zu den später so genannten ripuarischen Franken gehörten (wahrscheinlich Chatten und Ampsivarier, nebst den Brukterern). Sie hatten schon bei Lebzeiten seines Vaters den Rhein überschritten; nun schlug er sie und bekam ihre Fürsten Askarich und Regais (oder Merogais) gefangen Panegyr. VI (Eumen. Constantino), c. 11. 12.. In dem Amphitheater zu Trier, dessen gewaltige Überreste man noch jetzt in den Weinbergen aufsucht, wurden die beiden den wilden Tieren vorgeworfen; dasselbe geschah massenweise mit den gefangenen Brukterern, »die zu unverlässig waren, um als Soldaten, zu unbändig, um als Sklaven zu dienen«; »die wilden Bestien ermatteten ob der Menge ihrer Opfer«. – Noch zweimal, im Jahr 313 und 319, werden kurze Feldzüge gegen die Franken erwähnt, freilich bei den Geschichtschreibern nur mit einem Worte, woraus schon ihre geringe Bedeutung hervorgeht Etwas umständlicher Panegyr. IX, 23 und X, 17 und 18, hier mit offenbarer Übertreibung. Bei einem dieser Züge soll z. B. Constantin selber verkleidet die Feinde ausgekundschaftet und durch Zureden zum Angriff provoziert haben.. Constantin nahm sogar wieder von einem Stücke des rechten Rheinufers Besitz und erbaute zu Köln eine grosse steinerne Brücke, welche bis in die Mitte des zehnten Jahrhunderts vorhanden war, aber in einem so baufälligen und gefährlichen Zustande, dass Erzbischof Bruno, der Bruder Ottos des Grossen, sie abbrechen liess Fiedler, Rom. Gesch., 3. Aufl., S. 433. – Noch 1766 sah man bei niedrigem Rheinstande einige Pfeiler davon.. Den Brückenkopf bildeten die Castra Divitensia , das heutige Deutz. – Ein periodisches Fest, die Fränkischen Spiele ( ludi Francici ) verewigte diese Erfolge. Bei der Siegesfeier vom Jahr 313 stürzten sich die dem Tode geweihten Franken den wilden Tieren mit sehnsüchtiger Ungeduld entgegen.
Vergebens sucht man das Gesamtbild des alten Galliens, wie es unter Diocletian und Constantin sein mochte, weiter zu vervollständigen, indem die ergiebigern Quellen erst für die Zeit von Valentinian I. an zu fliessen beginnen. Von dem Los der Landbevölkerung kann man sich nach dem Obigen einen ungefähren Begriff machen. Der Gallier fühlte aber auch seine Not viel lebhafter als manche andere Bevölkerungen des Reiches. Schon physisch sehr bevorzugt, hoch und derb, hielt er etwas auf seine Person, liebte die Reinlichkeit und wollte nicht in Lumpen einhergehen. Er verzehrte viel, namentlich in Wein und andern berauschenden Getränken, hatte aber dafür jene Anlage des geborenen Soldaten, welche bis ins vorgerückte Alter keine Furcht kannte und keine Anstrengung mied. Man meinte, dies hänge mit seiner kräftigen Blutfülle zusammen und verglich ihn mit jenen magern, verkommenen Südländern, welche zwar mit einer Zwiebel des Tages ihren Hunger stillen, dagegen im Krieg ihr Blut sparen, dessen sie so wenig übrig haben Veget., De re milit. I, 2.. Auch die gallischen Weiber, blonde, gewaltige Figuren, scheuten den Streit nicht; sie waren furchtbar, wenn sie die weissen Arme aufhoben und ihre Schläge und Fusstritte »gleich Katapult-Schüssen« austeilten Ammian. Marc. XV, 12.. Eine solche Bauerschaft lässt sich nicht zuviel bieten, und ein gewisser Grad von Elend wird unvermeidlich den Ausbruch herbeiführen, wie damals geschah. – Allein auch in den Städten herrschte Not und Dürftigkeit; der wichtigste Besitz des Stadtbewohners in diesem fast ausschliesslichen Agrikulturlande war der ausgeliehene oder durch Knechte bewirtschaftete Boden, dessen Unglück der Eigentümer in vollem Masse mitempfand. Sodann erdrückte der Staat hier wie im ganzen Reiche durch das Dekurionenwesen auch die Wohlhabenden, insofern er die Besitzer von mehr als fünfundzwanzig Morgen Landes insgesamt für die fixen, oft noch willkürlich erhöhten Steuern des Bezirkes haftbar machte; eine Lage, welcher sich der einzelne bisweilen durch ganz verzweifelte Schritte, später selbst durch Flucht zu den Barbaren, zu entziehen suchte. Wenn man nun doch noch Beispiele von ausserordentlich reichen Leuten und einem grossen Luxus findet, so erklärt sich dies fürs erste durch das Fortbestehen der sogenannten senatorischen Familien, welche durch erbliche Verleihung Mitglieder des römischen Senates gewesen sein müssen und ausser ihrem Titel clarissimi und andern Ehrenrechten auch die Befreiung von dem Ruin der übrigen Städter, dem Dekurionat, für sich hatten. Ein anderer Grund liegt wohl in einem merkwürdigen Zuge des alten gallischen Nationalcharakters, welcher aus Liebe zu Parteiungen aller Art, später dann natürlich aus Not, beständig auf Verhältnisse der Klientel, des Schutzes Geringerer durch Mächtige, hindrängt. Schon Caesar Bellum Gall. VI, 13. fand in dieser Beziehung einen ganz ausgearteten Zustand vor; die Masse war bereits in die Knechtschaft des Adels geraten. Aber ein halbes Jahrtausend nach ihm kehrt dieselbe Klage fast unverändert wieder; Salvian De vero iudicio et provid. dei, l. V. bejammert das Los der kleinen Grundbesitzer, welche aus Verzweiflung über den Beamtendruck und die ungerechten Richter den Grossen des Landes sich und ihre Habe zu eigen überlassen. »Dann ist ihr Grundstück die Landstrasse Wenn fundos viarum quaerunt so zu übersetzen ist. und sie sind die Kolonen der Reichen! Der Sohn erbt nichts, weil der Vater einmal Schutz nötig gehabt hat!« – Auf diese Weise war es schon möglich, dass der einzelne Vornehme, der einzelne Grosspächter von Staatsländereien usw. ganz endlose Latifundien zusammenbrachte und dann wieder in antiker Weise gegen seinen Wohnort oder seine Provinz freigebig sein, zum Beispiel prächtige öffentliche Gebäude errichten konnte, während alles um ihn her darbte oder von seiner Gnade lebte. Ist dies im einzelnen für Gallien nicht nachzuweisen, so bleibt es doch die einzige Erklärung des Kontrastes zwischen der äussern Pracht der Städte (soweit dieselbe nicht kaiserliche Munifizenz war) und dem notorischen Elend. An Tempeln, Amphitheatern, Theatern, Triumphbögen, Fontänen, Thermen, Doppelpforten konnten namentlich die südgallischen Städte es mit den meisten italienischen aufnehmen, wie ihre Ruinen beweisen – noch jetzt die Zierden jedes betreffenden Ortes, wie sie einst als unversehrtes Ganzes den Dichter Ausonius entzückten. Abgesehen von Schenkungen mussten ohne Zweifel auch oft die Dekurionen aus ihrem eigenen und aus dem Stadtgut dergleichen Ausgaben bestreiten helfen. Von den Lehranstalten Galliens wird weiterhin die Rede sein; durch sie erhielt sich das Land seine bedeutende Stellung im Verhältnis zum römischen Geistesleben, auf welche es so stolz war. Denn man wollte ja nicht mehr zum alten Keltentum zurückkehren, sondern nach Kräften Römer sein; mit einem wahren Eifer muss das Volk zum Beispiel seine alte Sprache L. Dieffenbach, Celtica II, 84. Noch Anfang des dritten Jahrhunderts werden einzelne Urkunden keltisch abgefasst. – Vgl. besonders Panegyr. IX, c. 1. zu vergessen gesucht haben, die durch blosse römische Kolonisation und Verwaltung nicht so völlig zurückgedrängt worden wäre. Vielleicht gibt bis zu einem gewissen Grade der Sprachenzustand des Elsass eine Vorstellung des damaligen gallischen; die alte Sprache dauert im täglichen Leben fort, sobald aber ein Interesse höherer Bildung berührt wird, oder sobald man sich irgendwie offiziell zu gebärden hat, tritt die neue in ihr Recht, auf deren wenn auch mangelhafte Kenntnis alle Welt sich etwas zugute tut. Auch die alte Religion der Gallier hatte sich bequemen müssen, ein römisches Gewand anzuziehen, und die Götter haben sich nicht bloss (wo es anging) im Namen, sondern auch in der plastischen Darstellung dem römischen Stil gefügt, mag er auch nicht wenig provinziell verwildert erscheinen, sobald er sich über die alten, kunstverständigen Städte des Südens hinauswagt. In einem Falle mindestens hat aber der klassische Bildhauer auch ein rein keltisches Götterideal verwirklichen müssen, nämlich die geheimnisvollen Matronen Vgl. H. Schreiber: Die Feen in Europa, Freibg. 1842. – Auch diese ausgezeichnete Monographie hätte nebst mehrern andern dringend wünschen lassen, dass der seither verewigte Verfasser, welchem einst die erste Auflage dieses Buches gewidmet war, der deutschen Wissenschaft eine Gesamtdarstellung des Keltentums geschenkt haben möchte., welche in ihrem wunderlichen Kopfputz, Fruchtschalen auf dem Schoss, zu dreien nebeneinander zu thronen pflegen. Von einer ganzen Menge zumal lokaler Gottheiten, deren Namen sich schon deshalb nicht ins Lateinische übersetzen liessen, haben wir bloss die Weiheinschriften Orelli, Inscr. Lat. sel. I, cap. IV § 36 u. 37. – S. den V. Abschnitt. ohne Bildwerke.
Читать дальше