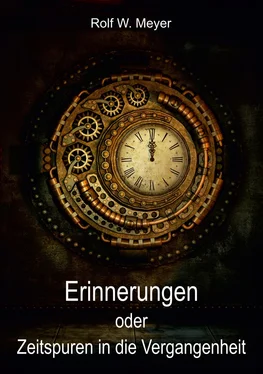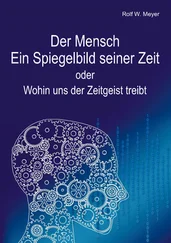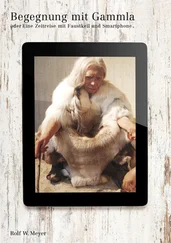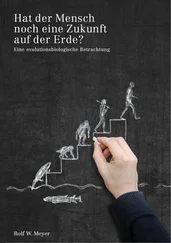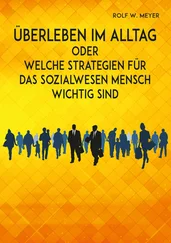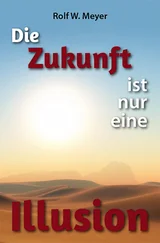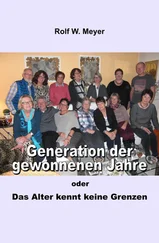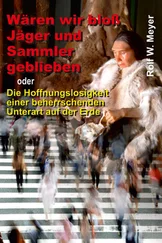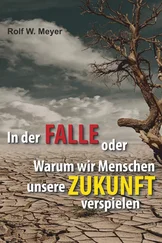1883 erwarb mein Urgroßvater das Vorwerk Haselbrunn bei Plauen im Zusammenhang mit einer Zwangsversteigerung für 62.500 Mark und zog mit der Familie dorthin. Zu dem Vorwerk, einem landwirtschaftlichen Gutshof, gehörten nicht nur ein umfangreicher Besitz an Weiden und Feldern, sondern auch eine Ziegelei im Heidenreich, nördlich der Bahnlinie Plauen – Leipzig. Vor dem Verkauf der „Hut“ hielt man auf dem Gut 30 Stück Vieh. In einer ungewöhnlich schnellen Entwicklung ihrer Industrie dehnte sich die Stadt Plauen immer mehr nach Norden aus. Dies führte zu einer unerwarteten Wertsteigerung der Grundstücke in Haselbrunn als Baugrund. So verkaufte mein Urgroßvater um 1890 70.000 qm Weideland an der „Rußhütte“ für 145.000 Mark und baute davon die Ziegelei aus. Ihre Erzeugnisse konnten nicht nur in Plauen, sondern auch in der ländlichen Umgebung abgesetzt werden. Am 1. Januar 1899 wurde Haselbrunn nach Plauen eingemeindet. Friedrich Otto Meyer, der in seinen letzten Lebensjahren einen Backenbart nach Kaiser Wilhelm I. trug, war im Gemeinderat des Dorfes Haselbrunn gewesen und hatte den Eingemeindungsvertrag mitunterzeichnet. Er starb 1901 an einem Herzschlag.
Friederike Liberta Meyergeborene Fischer, die einzige Tochter des Huf- und Waffenschmieds Johann Friedrich Fischer, war meine Urgroßmutter. Sie kam im März 1839 in Stöhna zur Welt. Sie war die treibende Kraft eines mehrmaligen Ortswechsels mit ihrer Familie, der mit einem sichtbaren Vermögenszuwachs verbunden war. Auch im Haselbrunner Unternehmen „Meyers Gut“ war sie der Mittelpunkt der Familie. Nach dem Tod ihres Mannes führte sie das Unternehmen mit Tatkraft weiter. Die umfangreichen Grundstücke um das „Meyers Gut“ herum (schon 1910 wird es in der Garnisonumgebungskarte so genannt) werden beschleust, die Haselbrunner Straße (in Gemeinschaft mit dem Nachbarn Roßbach) und die Hans-Sachs-Straße ausgebaut. In der Haselbrunner- und in der Morgenbergstraße werden in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts im Verlauf der „Blütezeit“ von Plauen einige Wohnhäuser als Spekulationsbauten finanziert. 1905 schloss meine Urgroßmutter des gesamten Grundstücks- und Ziegeleibesitz, der damals mit 1.300.000 Mark bewertet wurde, in den „Meyer’s Ziegelwerken GmbH“ zusammen. Zu den Gesellschaftern machte sie ihre vier Kinder. Ihre Söhne Friedrich Otto (mein Großvater) und Friedrich Albert wurden Geschäftsführer. Den Erwerbspreis der Grundstücke durch die GmbH stundete sie zinslos gegen die Eintragung von unkündbaren Hypotheken in der Höhe des Erwerbspreises. Auf diese Weise band sie ihre Kinder zusammen und diese an die Gesellschaft. Meine Urgroßmutter hatte die Ansicht vertreten: „Wer nicht mitmacht, wird enterbt!“ Ihre Geschäftsgewandtheit wurde nicht dadurch behindert, dass sie nur schlecht und nicht orthographisch richtig schreiben konnte. Auf der anderen Seite war sie tatkräftig, rührig, geschäftstüchtig, auf der anderen Seite konnte sie herrschsüchtig und oft auch rechthaberisch auftreten. Menschen, die mit ihr zu tun hatten, sahen überwiegend ihre positiven Charaktereigenschaften. So äußerte sich beispielsweise ein Notar, der mit ihr beruflich zu tun gehabt hatte: „Eine tüchtige Frau, die wusste, was sie wollte. In ihren Geschäften war sie weitblickend und großzügig.“ Von einem alten Schweizer, der auf ihrem Gut gearbeitet hatte, kamen die anerkennenden Worte: „Früh die Erste und abends die Letzte, … aber anständig zum Gesinde.“ Meine Urgroßmutter hielt sich Kutsche und Pferd und fuhr in ihren letzten Lebensjahren mit der Gummikutsche in die Stadt Plauen. 1906 verstarb sie in Haselbrunn.

Großeltern Friedrich Otto Meyer und Emma Elise Meyer geb. Baumann
Friedrich Otto Meyer,der 1872 in Herlasgrün im Vogtland im „Sächsisch-Bayerischen Bahn-Gasthof“ seiner Eltern zur Welt kam, war mein Großvater. Er besuchte die Schule in Limbach und kam 1883 nach Haselbrunn, als seine Eltern das Gut in Haselbrunn erwarben. Nach dem Besuch der Realschule in Plauen lernte er das Maurerhandwerk bei dem Maurerobermeister Friedrich Gustav Richter in Plauen und legte 1890 vor der Innung der Baugewerksmeister in Plauen die Gesellenprüfung ab. Als Maurergeselle arbeitete er in Elberfeld, Braunschweig und in Auerbach. In Großenhain und in Elsterberg (bei der Firma Piehler) arbeitete er als Bautechniker. 1899 legte er in Plauen die Maurermeisterprüfung und danach die staatliche Baumeisterprüfung ab. Von 1900 an war er als selbständiger Baumeister tätig. So erbaute er 1901 das Garnisonlazarett der Infanterie-Kaserne 134 und in der Folgezeit mehrere Wohnhäuser und Fabrikgebäude in Haselbrunn, das inzwischen nach Plauen eingemeindet worden war: Haselbrunner Straße 108, 110, 112; das Stickereigebäude Körner; die Maschinenfabrik Endesfelder & Weiß; die Eisengießerei Iwan & Winkel. 1903/1904 war er an dem Bau der Radrennbahn in Plauen-Kauschwitz beteiligt. Mein Großvater war Mitgründer der Kirchengemeinde St. Markus in Haselbrunn und Mitglied des Kirchenvorstandes von Anfang an. Während des Kirchenbaues 1912/13 war er Vorsitzender des Bauausschusses. Meine Großeltern stifteten für die Markuskirche den Altar, den Taufstein und ein Kirchenfenster.
Mein Großvater hing am Hergebrachten und war in der Lebensauffassung sowie in der Politik konservativ, zuweilen bis zur Einseitigkeit und in vorgefasster Meinung schwer belehrbar („Das bäuerliche Erbe wirkte nach.“). Sein Wesen war voll Gemüt. Er war sehr musikalisch und seine Lieblingslieder waren: „Traute Heimat meiner Lieben …“, „Nach der Heimat möchte ich wieder …“, „Ein getreues Herze wissen …“. Er war von tiefer und überzeugter Gottgläubigkeit, die ihn in vielem eine Stütze war. 1933 starb er laut betend nach einem Leben voller Sorgen, Mühen und Entsagungen, in dem seine Fürsorge für die Familie stets im Vordergrund stand.
Emma Elise Meyergeborene Baumann wurde 1879 in Elsterberg als 5. Kind meiner Urgroßeltern Christian Friedrich und Mathilde Therese (eine geborene Lenk) Baumann in Elsterberg geboren. Im Familienkreis wurde sie „de Kleene“ genannt. Im kleinbürgerlichen Elsterberg im Vogtland wuchs sie auf, besuchte dort die Schule und erlernte auch das Klavierspiel. Nach der Schulzeit war sie für einige Monate bei einem Geschäftsfreund ihres Vaters in Düsseldorf und in einem „Marthaheim“ in Leipzig, um Hauswirtschaft zu lernen. In Elsterberg lernte sie das Kochen in der Gaststätte „Goldenes Lamm“ am Marktplatz. Mein Großvater verkehrte in dieser Zeit dort. 1901 heirateten meine Großeltern.
Die Zahl der Kinder (zwei Söhne, vier Töchter) kennzeichnete ihren Lebensweg. Sie führte das Leben der Frauen des Bürgertums am Anfang des 20. Jahrhunderts, die, für Familie und Haushalt erzogen, in diesem Pflichtenkreis aufgingen. Meine Großmutter war fleißig, sparsam, wirtschaftlich und offenherzig. Sie hat keine Arbeit in den schweren Hungerjahren des Ersten Weltkrieges gescheut. Sie lebte nur für die Familie. Aus dem kleinstädtischen Haushalt ihrer Eltern in Elsterberg kannte sie Arbeiten des „Ackerbürgers“ aus eigener Erfahrung und führte danach ihren Haushalt. Sie war unermüdlich. Bis zum Ersten Weltkrieg hatte sie das zeit- und standesgemäße „Dienstmädchen“, dann schaffte sie es mit den heranwachsenden Kindern allein. Als ihre Familie in der Not des Ersten Weltkrieges Viehzeug halten musste, wie etwa Hühner, Gänse, Ziegen, Schweine und viele Karnickel, hatte sie auch das bewältigt. Sie konnte schlachten, Wild und Geflügel ausnehmen, backen und verrichtete jede Gartenarbeit. Sie strickte und häkelte, nur das Nähen lag ihr nicht. Sie konnte melken und wusch, als es nicht mehr anders ging, auch die Wäsche für die ganze Familie.
Читать дальше