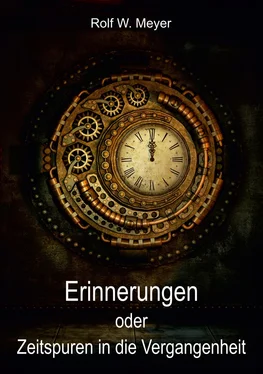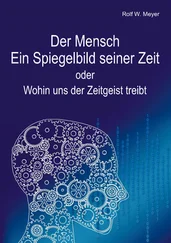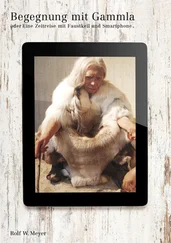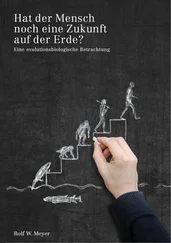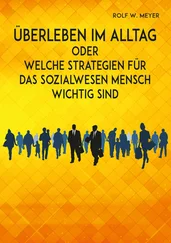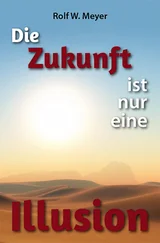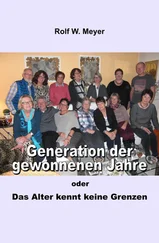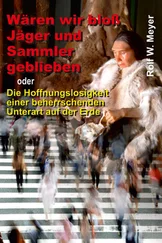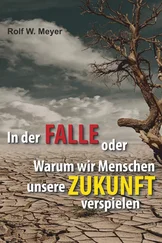Historisch interessant ist, dass die Schäferei schon vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) und bis in das 18. Jahrhundert hinein in hoher Blüte stand. Die Schafwirtschaft war bedeutungsvoller als die Pferde- und Schweinezucht. Daher genoss der Schäfer höheres Ansehen als andere Hirten. Schäfer brachten es oft zu beträchtlichem Wohlstand und bewirtschafteten Güter nur mit großen Schafherden. Schafwolle war ein wertvoller Rohstoff gewesen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts führte die Ablösung und Aufhebung der Weiderechte, vor allem in Wäldern, und der Verfall der Wollpreise mit dem Aufkommen der Baumwolle allerdings zum Niedergang der Großschäferei.
Die Bezeichnung „Meister“ ist nicht im Sinne des modernen Gewerberechts zu verstehen. Sie ist eine allgemeine Bezeichnung, die Berufen zugesetzt wurde. „Keßlerischer Schäfer“ wird bedeutet haben, dass Andreas Meyer ein einstmals herrschaftliches Gut einer Familie dieses Namens in Pacht oder Lehn bewirtschaftete oder auch der Schafmeister des Gutes in dessen Dienst war.
Das sechste Kind von Andreas Meyer, sein Sohn Johann Michael Meyer (1730–1796), lebte in Ritteburg als Landwirt und war zweimal verheiratet gewesen. Seine Ehefrau in zweiter Ehe war Christiane Augustine (1755–1814), die Tochter des Pachtschäfers Johann Andreas Werfel aus Unterröblingen. Sie hatten, mit dem Kind aus der ersten Ehe, sieben Kinder, unter deren Paten wiederholt Schäfer genannt werden.
Das sechste Kind aus der zweiten Ehe, Johann Gottlob Meyer (1789–1861) wurde Müller. Er verließ, offenbar dem Wandertrieb dieses Handwerks folgend, die Heimat und heiratete am 14. Januar 1820, in Markleeberg bei Leipzig die 28jährige Tochter Johanna Magdalene des „Pferdners und Nachbarn“ Johann Daniel Otto aus Beucha bei Borna, der ein gelernter Brauer war. Johann Gottlob Meyer muss es zu Wohlstand gebracht haben, denn schon bei der Geburt seines zweiten Sohnes, Friedrich Otto (1830–1901), ist er Pachtmüller in Markleeberg. Seit etwa 1850 hat er das Rittergut Probstdeuben als Pächter bewirtschaftet. 1863 wird er als Rittergutspächter in Probstdeuben bezeichnet. Johann Gottlob Meyer verstarb im Alter von 72 Jahren in Probstdeuben, seine Frau Johanna Magdalene im Alter von 76 Jahren in Herlasgrün. Der zweite Sohn von Johann Gottlob und Johanna Magdalene Meyer, Friedrich Otto Meyer, war mein Urgroßvater.
Der Familienname Meyer tritt allein in den Kaufverträgen mehrmals auf (Sophia Dorothea Meyer, Hausvogt Jakob Meyer). 1713 werden als Paten der Gemeindebäcker Hans Jakob Meyer und die Witwe Maria des Christian Meyer genannt. 1936 war in Ritteburg noch ein Landwirt mit dem Namen Friedrich Meyer (geboren 1879) ansässig, der zwei Brüder hatte (geboren 1887 und 1892). Von ihnen kam der Hinweis, dass „nach mündlicher Überlieferung die Vorfahren aus Schlesien gekommen seien“.
„Vielleicht wirken die Taten und Leiden der Vorfahren noch in ganz anderer Weise auf unsere Gedanken und Werke ein, als wir Lebenden begreifen. Aber es ist eine weise Fügung der Weltordnung, daß wir nicht wissen, wieweit wir selbst das Leben vergangener Menschen fortsetzen, und daß wir nur zuweilen erstaunt merken, daß wir in unseren Kindern weiterleben.“
Gustav Freytag (1816–1895)
2 Wie die Vorfahren gelebt haben
| Geschichtliche Ereignisse: |
| 1839 |
Das preußische Regulativ vom 9. März über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken verbietet Kinderarbeit vor Vollendung des neunten Lebensjahres. Es gilt als das erste deutsche Gesetz zum Arbeitsschutz. |
| 1864 |
Am 13. November wird die Liberty Party als erste Partei der Anti-Sklaverei-Bewegung in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Theodor Schwann und Matthias Jakob Schleiden begründen die Zelltheorie. |
| 1883 |
Der erste Teil von Friedrich Nietzsches dichterisch – philosophischem Werk „Also sprach Zarathustra“ erscheint. |
| 1899 |
Am 11. August eröffnet Kaiser Wilhelm II. den Dortmund-Ems-Kanal. Das östliche Ruhrgebiet hat damit einen Schiffsweg zur Nordsee. |
| 1910 |
Am 20. Dezember kann Ernest Rutherford den experimentellen Nachweis von Atomkernen erbringen. |
| 1920 |
Am 10. Januar tritt der Friedensvertrag von Versailles in Kraft. |
2.1 Vorfahren väterlicherseits
Johann Friedrich Fischerwar mein Ururgroßvater. Er kam 1806 in Löbnitz zur Welt. Diese Ortschaft liegt an der Mulde, einem linken Nebenfluss der Elbe, zwischen der Leipziger Tieflandsbucht und der Dübener Heide. Als Siebenjähriger hatte er in Stöhna den Durchmarsch preußischer Truppen erlebt, die im Herbstfeldzug 1813 im Rahmen der Freiheitskriege gegen die Vorherrschaft Frankreichs unter Napoleon Bonaparte in der Völkerschlacht bei Leipzig eingesetzt wurden. Diese militärische Schlacht, die vom 16. Bis 19. Oktober 1813 geführt wurde, war die Entscheidungsschlacht der Freiheitskriege, auch Befreiungskriege genannt. Napoleon Bonaparte musste damals seine Truppen über den Rhein zurückziehen.
Mein Ururgroßvater Johann Fischer hatte den Beruf eines Huf- und Waffenschmiedes gelernt und viele Jahre in Stöhna ausgeübt. Auf Wanderschaften war er weit herumgekommen. Von dem ersparten Kapital lebte er später bei seiner Tochter Friederike Liberta in den vogtländischen Ortschaften Herlasgrün und Haselbrunn. Erwähnenswert ist, dass der Bau der Bahnstrecke Leipzig – Plauen – Hof von 1846 bis 1851 die Ortschaft Herlasgrün und das Leben seiner Einwohner gravierend verändert hatte. 1846 begann nämlich die Sächsisch-Bayerische Eisenbahn-Compagnie mit dem Bau von zwei Brücken, die die geplante Bahnstrecke Leipzig – Hof ermöglichen sollten: die Göltzschtalbrücke (sie ist die bisher größte Ziegelsteinbrücke der Welt) und die Elstertalbrücke. 1847 übernahm die Sächsisch-Bayerische Staatseisenbahn den Weiterbau und stellte am 15. Juli 1851 beide Brücken gleichzeitig fertig. An diesem historischen Bau der Göltzschtalbrücke hatten mein Ururgroßvater und seine Tochter Friederike Liberta mit gut verdient. Denn in der Nähe der Baustelle hatten Vater und Tochter die Bauarbeiter verköstigt und so den Grundstein für ein Vermögen gelegt.
Von Herlasgrün aus lief Johann Fischer nach Art eines Schmieds in Lederpantoffeln bis nach Reimersgrün. Von Haselbrunn aus fuhr er noch in den 1880er Jahren mit der Eisenbahn in der 4. Klasse (wobei er einen Feldstuhl benutzte, da es dort keine Sitzplätze gab) nach Lucka im Altenburger Land. Von dort aus wanderte er nach Leipzig zur Messe, um seinen Tabakbedarf (einen ganzen Sack voll) einzukaufen. Am 2. März 1888 verstarb mein Ururgroßvater in Haselbrunn.

Urgroßeltern Friedrich Otto Meyer und Friederike Liberta Meyer geb. Fischer
Friedrich Otto Meyer,der 1830 in Markkleeberg bei Leipzig zur Welt kam, war mein Urgroßvater. Er erlernte den Beruf eines Landwirtes („Ökonom“). Die Lehrzeit erfolgte von 1845 bis 1849 in Probstdeuben, die er 1849 bis 1854 auf einem Gut bei Bautzen fortsetzte. 1855 kehrte er nach Probstdeuben zurück, wo sein Vater Johann Gottlob Meyer ein Rittergut zur Pacht übernommen hatte. 1863 heiratete er die 24jährige Tochter Friederike Liberta des Huf- und Waffenschmiedes Johann Friedrich Fischer in Stöhna bei Leipzig. 1864 kaufte mein Urgroßvater einen Landgasthof, den „Sächsisch-Bayerischen Hof“, im vogtländischen Herlasgrün. Dieser Landgasthof befand sich unmittelbar am Bahnhof Herlasgrün an der Bahnstrecke Leipzig-Hof, etwa 10 km südlich von Reichenbach. Da der Bahnhof Umsteigeort für die Bahn-Nebenstrecke Herlasgrün – Treuen – Auerbach war, hatte er größeren Fremdenverkehr.
Читать дальше