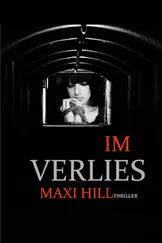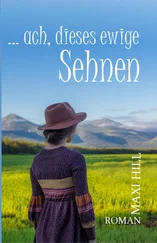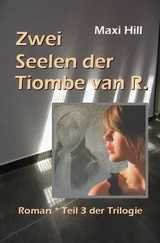Mit Schrecken wird Ashanti klar, dass sie ohne ihre Mutter völlig verloren wären. Sie haben mit freiem Willen alle Türen hinter sich zugeschlagen und sie wissen, dass sie ihre Heimat nie wiedersehen.
Sie schiebt ihre Bedenken beiseite. Einmal wird Frieden sein zwischen den Völkern und auf der Welt. Sie lächelt bei dem Gedanken, aber ihr wird ganz übel, wenn sie ihre Mutter so hilflos sieht, jetzt, wo die größte Anstrengung noch bevorsteht.
Sie fühlt sich verlassen und doch muss sie stark sein. Sie musste schon immer stark sein. In der alten Heimat litt sie darunter, dass ihr Vater als Feind angesehen wurde. In der neuen Heimat stand ihr die Mutter, die liebevoller und schöner war als andere Frauen, sogar als Makel im Wege der Anerkennung durch ihre Mitschülerinnen. Mutter ist vom Stamme der Chokwe, christlich, und sie spricht die Sprache Cokwe, weil deren Mutter sie anders nicht verstand. Ashantis Vater war vom Stamme der Holo. Seine Vorfahren huldigten einem ethnischen Gott und alle sprachen sie Kimbundo. Aber mit den Kindern sprachen Vater wie Mutter afrikaans oder portugiesisch, in der neuen Heimat dann französisch.
Um sie herum noch immer dieselben Menschen. Nur ihre Gesichter sind verändert. Misstrauisch. Enttäuscht. Wütend. Apathisch. Sie alle haben dunkle Haut, ähneln einander in Habitus und Gestus. Sie sprechen afrikanische Sprachen und haben dasselbe Schicksal seit Jahrhunderten zu tragen. Nur weil sie nicht demselben Gott huldigen, nicht demselben politischen Führer folgen, sind sich die Völker seit langer Zeit feind. Jetzt, auf ihrem Weg ins Ungewisse, huldigen sie demselben Gott Europa, den – wie jeden Gott - noch keiner von ihnen gesehen hat, dem man Wunder zutraut, wie sie nur im Paradies vorkommen…
Ashanti bedrückt ein Gefühl der Ohnmacht. Noch vor der Flucht erklärte Mutter Dzemila, eine Aussöhnung würde noch Jahrhunderte dauern. Sie könnten darauf nicht warten, vermutlich würden dieses Wunder nicht einmal ihre – sie meinte Ashanti - Kinder erleben. In Europa müsste man keine Überfälle fürchten, keine Seuchen oder Hunger, keine Entführung oder Tod. Nicht einmal wilde Tier gäbe es dort zwischen baumhohen Häusern und spiegelglatten Straßen.
Was, wenn es auch dort Menschen gibt, die uns nicht empfangen möchten? Böse Menschen, die mit den Säbeln rasseln, die aus allen Rohren Feuer spucken?
Bevor der Abend naht, schicken die Frauen die beiden Kinder fort von ihrer kranken Mutter. Ashanti mit ihren beinahe sechzehn Jahren ist unweigerlich in Sorge. Der achtjährige Kanzi ist froh, den ablehnenden Blicken der Frauen und der kühlen Gleichgültigkeit der jungen Männer nicht mehr ausgesetzt zu sein.
Noch ist heller Nachmittag und so drückend heiß, dass sie im schmalen Schatten einer kleinen Felsengruppe erschöpft sitzen bleiben. Ashanti drückt Kanzis Kopf in ihren Schoß, und schon bald spürt sie seinen gleichmäßigen Atem. Sie ist voller Hoffnung, die Frauen haben etwas erdacht, womit sie Dzemila helfen können. Der Gedanke daran lässt sie die strikte Verbannung ertragen: Falls sie den Körper der kranken Mutter entblößen müssen, wäre das kein Anblick für den kleinen Kanzi. Hier im Schatten der hohen Felsen, die der Sand noch freigibt, wird er zur Ruhe kommen…
Kanzi hängt zu sehr an seiner Mama, seit der Vater nicht mehr nachhause kam. In einer solchen Wüste wie dieser soll er verschollen sein. Das sagten die, die ihn vermutlich auf dem Gewissen haben. Seit ein paar Tagen kann Ashanti die Lüge der Männer, wie es Mutter nannte, sogar glauben. Diese Wüste ist nicht fürs Leben gemacht. Nur der Glaube an das baldige Ziel, wie es der Anführer Nsenga sagte, hält die Moral der kleinen Gruppe aufrecht.
Ihr Blick streift durch die Trostlosigkeit; ihr Herz hält dabei Schritt. Wenigstens an eines hätte sie denken sollen. Das Märchenbuch aus Mutters Tasche. Etwas vorzulesen lenkt den kleinen Bruder ab von seiner Seelennot, der er noch nicht gewachsen ist. Schon auf dem LKW jammerte er immer wieder in Mutters Schoß, er wolle endlich wieder nachhause. Auf dem Weg durch den Sand wurde es schlimmer und schlimmer…
Nach vermutlich zwei Stunden regt sich der Bruder und schrickt hoch. Ashantis Leib ist erstarrt, wie der Stein, an dem ihr Rücken lehnt. Mit ihrem Schal, der sie zugleich gegen die Sonne bei Tage wie gegen die Kälte bei Nacht, aber auch gegen den feinen Sand geschützt hat, betupft sie seine schweißnasse Stirn und danach den eigenen Hals und ihre Schläfen, von denen das Wasser wie in Strömen herunterfließt und zwischen ihren festen Brüsten seinen Weg sucht.
Kanzi windet sich aus ihren schützenden Armen und verlangt vehement nach der Mama, aber Ashanti weiß, sie würde den Zorn der Frauen auf sich ziehen, wenn sie vorzeitig zurück zur Gruppe kämen. Sie muss ihnen Zeit geben, ihrer Mutter wegen. Also erzählt sie davon, womit Mutter Dzemila zuletzt den kleinen Bruder in den Schlaf geleitet hat, so oft, dass Ashanti die Geschichte auswendig kann. Sie wusste damals nicht, warum die Mutter gerade davon immer wieder las. Seit ihrer heimlichen Flucht weiß sie es, aber es bringt nicht dieselbe Freude in sie wie alles andere, das sie in ihrem Leben auswendig gelernt hat.
»Kanzi. Warum es Schwarze und Weiße gibt, das weißt du schon«, beginnt sie. »Wir müssen das jetzt immer bedenken. Schon bald werden wir im Land der Weißen sein.«
Kanzi nickt und sie spürt, wie er sofort ruhig wird.
»Ich erinnere dich daran…« Mit einem tiefen Seufzer und dem hilfesuchenden Blick in den wolkenlosen, wenig Trost spendenden Himmel beginnt sie zu erzählen. »Vor vielen Jahren hatte ein Mann zwei Söhne: Manikongo und Songa. Als der Vater sie aufforderte, im See zu baden, wurde Songas Haut weiß, aber Manikongas blieb dunkel wie die seines Vaters. Fortan griffen die Brüder auch nach verschiedenen Gegenständen. Songa bevorzugte Papier, Schreibfedern, Gewehr und Schießpulver, Manikonga liebte die Kupferarmbänder, die Eisensäbel sowie Pfeil und Bogen. Der Vater befand: So verschieden konnten seine Söhne nicht mehr im tiefen Afrika zusammen leben. Er schickte sie auf Wanderschaft. Songa erreichte das Meer, setzte über und wurde auf der anderen Seite der Welt der Vater aller Weißen. Manikonga blieb und wurde der Vater aller Menschen mit dunkler Haut.«
Kanzi räkelt sich: »Mama sagt, alle Menschen gehören zusammen.«
»Oh ja, wir alle sind Brüder, sagt Mama.«
Das gefällt Kanzi. Warum sollte er nicht zu einem Bruder reisen? Er selbst hätte gerne einen Bruder gehabt, aber er hat nur eine Schwester.
Als man sie endlich zur Gruppe zurückholt, singen ein paar der Frauen und die anderen Kinder stehen wieder etwas abseits. Es ist nicht mehr hell genug, doch Ashanti spürt genau, wie sie mit merkwürdigen Blicken beäugt werden, wie die Frauen ihre Gesänge unterbrechen und wie das rhythmische Beugen ihrer Körper nach dem Takt einer Klagefrau mit einem Mal weniger tief und weniger elegisch ausfällt.
Zwei Steine an Mutters Seite sind für die beiden Kinder gedacht. Seit Tagen ersetzen Steine die nötigen Dinge des Lebens. Sie dienen als Möbel. Die größeren Brocken dienen als Schutz vor den Blicken Fremder, wenn sie ihre Notdurft verrichten. Zwei mittelgroße Steine dienten sogar als Bremse, als der LKW auf einer sandigen Anhöhe an Kraft verlor und bald völlig versagte. Aber jetzt…?
Die anderen Kinder und ein paar der jungen Männer treiben sich in Sichtweite zwischen den Felsen herum und sammeln noch mehr Steine. Größere, kleinere…
Als eine der Frauen ein unmerkliches Kommando gibt, durchfährt Ashanti ein Stich. Die Frauen singen mehrstimmig, wie es ein geübter Gospelchor nicht erbaulicher könnte. Ihre Körper beugen und strecken sich jammern und zeternd, wie es Ashanti nur von einer komba kennt – einer Totenfeier.
Читать дальше