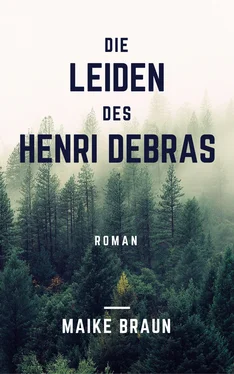„Haben Sie Kinder?“, frage ich.
Er hält inne. Schaut mich an. Schüttelt den Kopf.
Ich möchte gern Kinder. Mit Kindern ist alles anders. Sie vertäuen einen in der Welt.
Ich erzähle ihm von einem Mädchen, das ich unten im Hof bei den Waschweibern gesehen habe.
„Sie ist nicht wie die anderen“, sage ich und verstumme.
Wie soll ich es ihm erklären?
Über den Schreibtisch hinweg greift er nach meinem Arm, nimmt meine Hand in die seine. Er wird mich festhalten, wenn ich wieder weglaufen will. Das spüre ich.
Er bittet mich, weiter zu sprechen.
„Ich höre einen Namen. Von einer Stadt, von einem Land. Dann kommen die Kopfschmerzen, alles verschwimmt und ich marschiere los. Ich suche diesen Namen, diese Stadt, dieses Land. Als ob ein Fremder sich meinen Körper ausleiht. Mit ihm spazieren geht. Quer durch Europa.“
Ich blicke auf, er nickt mir zu, ich fahre fort.
„Wenn dieser Herumstreuner, dieser Dieb, genug hat oder in Schwierigkeiten gerät, lässt er meinen Körper am Straßenrand liegen wie einen ausgetretenen Schuh. Dort finde ich mich wieder.“
„An mehr erinnern Sie sich nicht?“
Ich schüttle den Kopf. Er lässt meine Hand los. Gleich wird er mich wegschicken. Doch er notiert nur etwas in seinem Buch. Die Feder tanzt über das Papier. Ein schöner Anblick. Ich möchte auch tanzen lernen.
Die Tür fliegt auf. Eine Schwester marschiert herein. Nicht die von der Station. Eine andere. Mit Augenbrauen quer über das Gesicht wie ein Galgen.
„Hier stecken Sie also“, sagt sie streng und knallt einen Stapel Akten auf den Schreibtisch des Doktors.
„Schwester Marguerite, würde es Ihnen etwas ausmachen?“, sagt der. „Ich führe gerade ein Gespräch mit einem Patienten.“
Eine ihrer Augenbrauen krümmt sich.
„Das würde es“, sagt sie.
Der Doktor sieht wütend aus. Seine Lippen ziehen sich in den Bart zurück.
Aus einem an ihrem Gürtel befestigten Beutel holt sie ein braunes Glasfläschchen, streckt es mir entgegen. Es sieht aus wie das, aus dem sie dem Kranken auf der Station gegeben haben. Ich will nicht ruhig gestellt werden. Ich will nicht festgeschnallt werden.
Ich stehe auf. Sie packt mich am Arm. Ich schüttle sie ab.
„Jeden Morgen nehmen Sie davon einen Löffel. Dann fühlen Sie sich spätestens in einem Monat besser“, sagt sie.
„Ich bin nicht wie der Mann heute Morgen. Ich bin nicht verrückt.“
„Deswegen bekommen Sie ja auch etwas anderes“, sagt sie.
„Was ist das?“, fragt der Doktor.
Sie sagt etwas, das ich nicht verstehe, fügt „Gegen seine Fallsucht“ hinzu.
Ich falle nicht, ich verschwinde. Ich hebe die Hand. Will sie aufklären.
„Keine Widerrede. Sie gehen jetzt nach Hause und schlucken brav jeden Tag Ihre Arznei.“
Nach Hause? Ich will nicht nach Hause. Dort kommt er wieder, der Dieb.
„Ich möchte hier blieben - beim Doktor.“
Die Schwester bleckt die Zähne. Sie sind schief.
„Der Doktor ist noch gar kein Doktor“, sagt sie. „Der einzige Doktor, den es hier gibt, ist der Herr Professor. Und der sagt, Sie sollen nach Hause gehen.“
Ich schaue den Doktor an, der keiner ist.
„Ich rede mit dem Professor“, sagt er.
„Trotzdem gehen Sie jetzt nach Hause“, sagt die Schwester.
Ich drücke mich gegen die Wand. Ich will da nicht hinaus, wo sie mit Gurten warten und den Patienten Pech einflößen.
Die Schwester faucht den Doktor an. Er schnaubt zurück. Mein Schädel pocht.
Wie soll mich der Doktor heilen, wenn ich nicht im Hospital bin?
„Henri, bitte tun Sie, was Schwester Marguerite sagt.“
„Herr Doktor, Monsieur, lassen Sie mich nicht im Stich.“
Der Doktor legt seine Hände auf meine Schultern, blickt mich an. Seine Augen haben die Farbe von Harz in der Sonne. Fast kann ich die Pinien riechen. Er verspricht mir, mich nicht im Stich zu lassen. Er gibt mir sein Wort.
Die Schwester drängt mich zur Tür hinaus. Ich drehe mich zum Doktor um. Er wird mich heilen. Er muss mich heilen.
„Sie haben es mir versprochen.“
Ich stolpere über die Türschwelle. Die Tür fällt zu. Der Doktor ist verschwunden.
„Tisson, was gibt’s denn nun schon wieder?“
Aupy blickte kurz von seinem Schreibtisch auf, dann wühlte er weiter in den Unterlagen, die darauf verstreut waren.
„Ich wollte mit Ihnen nochmals über Henri Debra sprechen.“
Aupy beugte sich quer über den Schreibtisch und deutete mit dem Finger auf den Boden. „Liegt da etwas?“
Tisson wollte gerade den Kopf schütteln, als er unter dem Tisch eine Zeichnung entdeckte. Auf dem Blatt war ein Zackenmuster abgebildet, das Tisson entfernt an die Umrisse einer mittelalterlichen Befestigungsanlage erinnerte. Er reichte sie Aupy.
„Wegen Henri Debra“, begann er erneut.
Aupy verglich die Zackenlinie mit einer ähnlichen in der aktuellen Ausgabe der Revue Médical .
„Wusste ich es doch“, murmelte er, klappte das Journal zu und musterte Tisson. „Was ist mit ihm? Wenn er sich weigert, seine Arznei zu nehmen, binden Sie ihn fest.“
Tisson winkte ab. Das sei nicht nötig. Der Patient sei kooperativ. Er habe sich gerade lange mit ihm unterhalten. „Seine Krankheit ist recht ungewöhnlich. Ein Anfall scheint bei ihm den Zwang zu reisen hervorzurufen.“
Aupys Schnurrbart zuckte. „Was wollen Sie mir damit sagen? Dass er nicht entlassen werden soll? Wollen Sie mich belehren?“
„Nein, sicher nicht. Ich würde ihn nur gern etwas länger beobachten. Er könnte doch einmal die Woche zur Nachuntersuchung ins Hospital kommen.“
„Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, unser Gebiet ist die Hysterie und nicht die Epilepsie? Im Übrigen: Wie behandelt man die Fallsucht?“
„Mit Brom Kalium.“
„Exakt. Genau das bekommt er. Hat Ihnen Schwester Marguerite nicht die Krankenakten gebracht?“
Tisson nickte.
“Dann sind Sie doch beschäftigt. Studieren Sie die Akten. Machen Sie eine Aufstellung über sämtliche Neuzugänge im letzten Jahr. Alter, durchschnittliche Verweildauer, Häufigkeit der Anfälle, Symptome etcetera etcetera. Vor allem aber achten Sie auf Störungen im Sehvermögen. Notieren Sie, welcher Art diese Störungen sind. Im Zweifelsfall befragen Sie die Patientinnen erneut.“
Aupy setzte sich an den Schreibtisch, schob die Papiere zur Seite, zog ein leeres Blatt aus der Schublade hervor und begann zu schreiben.
„Auch bei Henri kündigt sich ein Anfall durch eine Verengung des Sehfeldes an.“
„Tisson! Wenn ich noch einmal diesen Namen höre, können Sie Ihre Sachen packen und sich von mir aus als Landarzt im Finistère niederlassen.“
Die nächsten Wochen verbrachte Tisson damit, das Sehvermögen aller Neueinweisungen der letzten sechs Monate auszuloten. Er maß die Farbwahrnehmung, die Sehstärke und die Ausdehnung des Gesichtsfeldes. Letzteres stellte die aufwändigste Messung dar. Dazu arretierte er den Kopf der Patientin, wies sie an, einen zentralen Punkt zu fixieren und bewegte dann einen Metallstift auf einem Försterbogen, einer halbkreisförmigen Schiene, langsam von außen in Richtung Nasenspitze. Die Patientin gab ein Handzeichen, sobald sie den Stift wahrnahm. Dasselbe wiederholte er in Zwanzig-Grad-Schritten bis er einen Halbkreis durchschritten hatte.
Schob er den Stift zu schnell, wurde die Messung ungenau. War er zu langsam, verloren die Patientinnen die Geduld und begannen die Augen hin und her zu bewegen. Dann musste er wieder von vorne beginnen. Darüber hinaus beklagten sich die Frauen ständig, dass er nicht mit ihnen rede. Er versuchte ihnen zu erklären, dass er sich konzentrieren müsse. Doch einige schienen sich regelrecht einen Spaß daraus zu machen, ihn abzulenken. Vor allem die Mädchen, die sich schon länger im Hospital befanden. Tisson nahm sich vor, mit Schwester Marguerite darüber zu sprechen, wie man den Alltag für die Patientinnen interessanter gestalten könne, damit diese nicht ihre gesamte jugendliche Vergnügungssucht an ihm austobten.
Читать дальше