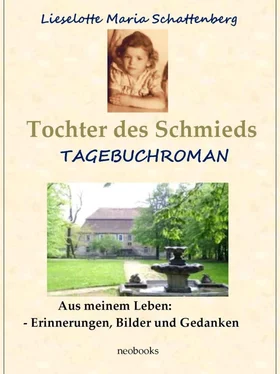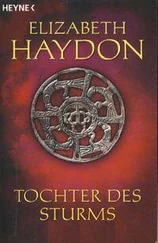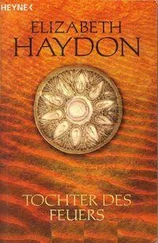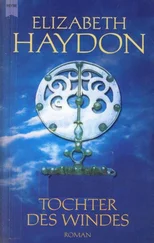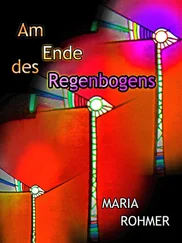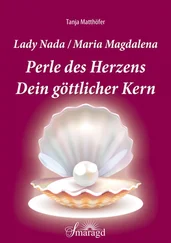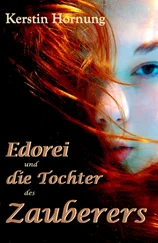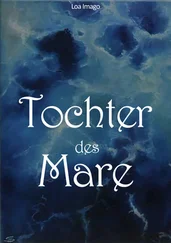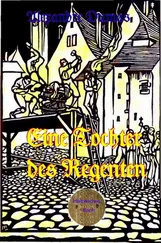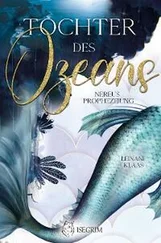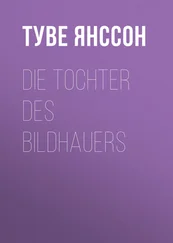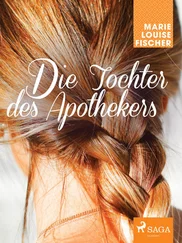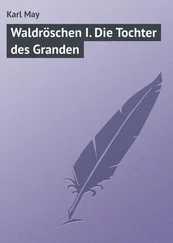In unsere Streitigkeiten mischten sich die beiden älteren Brüder nicht ein. Bei ihnen ging es um wichtige Dinge wie Freundinnen, Haarpomade oder Kleidungsstücke, die sie gegenseitig austauschten. Nur mit den Freundinnen gab es Ärger, wenn die beiden dem gleichen Mädchen nachliefen.
Dann stellte ich mir vor, wie es sein könnte, wenn ich endlich erwachsen wäre. Mit den Jungen gäbe es kein solches Gerangel wie bei den Brüdern, ich würde ja den Kurt nehmen, der im Kindergarten neben mir saß.
Später würden wir in der Stadt leben und mit dem eigenen Auto ins Dorf zu Besuch kommen. Dann würden wir die Leute sagen hören: „Nu kiek sich eener an, die kleene Flüchtlingskröte, wat so aus der jeworden is. Und solch schicket rotet Auto."
Dem kleinen Klaus erzählte ich von meinen Träumen. Wir gingen noch nicht zur Schule, und die Mutter nahm uns mit zu dem Stück Acker am Dorfrand. Genau daneben verlief die Autobahn und unsere Phantasie führte uns von der Brücke zu unbekannten Zielen, indem sich jeder einen passenden Wagen aussuchte. Es gab den VW Käfer, den Opel Kapitän, den Ford Taunus, Porsche und Mercedes, die zu dieser Zeit gebaut wurden und unser Dorf in schnellem Tempo streiften. Noch kannten wir die Namen nicht, waren jedoch voller Bewunderung.
Nach den Jahren des Verzichts und der Not vermittelte das Auto den Deutschen ein neues Freiheitsgefühl. In den 50er-Jahren konnten die meisten Deutschen jedoch nur vom eigenen Auto träumen.
Mutter redete nicht über Politik. Sie hatte mit dem Vater gemeinsam sechs Mäuler zu stopfen und den Hof voller Tiere zu versorgen, das war Arbeit genug.
„Vertragt euch doch, Kinder, " waren ihre ständigen Worte. Die Familie am Leben zu erhalten, war in diesen Nachkriegsjahren ein täglicher Kampf. Uneinigkeiten unter uns Kindern strapazierten die Nerven der Eltern.

Die Bauern waren, ausgerüstet mit der Sense, schon in der Frühe um drei Uhr auf der Wiese zum Mähen. Das Frühstück nahmen sie erst gegen sieben Uhr morgens ein. Da waren in einem Korb gekochte Eier, Brot und Malzkaffee für die Pause, die allerdings nur kurz gehalten wurde.
Sechs Stunden, mit kurzer Unterbrechung während der Essenspause, wurde gemäht. Die Mäher schritten einer hinter dem anderen. Für die jungen Leute, die noch wenig Erfahrung im Mähen hatten, war das wohl sehr anstrengend, weil der beste Mäher das Tempo bestimmte und die anderen sich nach ihm richten mussten. Es galt zudem als Schande, von einem anderen Mäher überrundet zu werden. Man brauchte doch auch eine gewisse Zeit, seine Sense zu wetzen. Freudig wurde nach so viel Mühe die Person begrüßt, die das Essen für die Leute brachte.
Menschen und Tiere beköstigten sich in diesen Wochen im Hochsommer auf dem Feld.
Die Kühe und Pferde wurden mittags getränkt. Hierzu standen lange Holztröge am Rand der Koppelweide, in die man aus einer Tonne das kostbare Wasser füllte, schon leicht angewärmt von der Tageshitze. Die Sonne glühte, es gab keinen Schatten auf der Wiese. Wer eine Verschnaufpause brauchte, suchte sich ein schattiges Plätzchen unter den Eichen am Feldrand. Heute hatten sie an den großen Wiesen am Busch zu arbeiten, die vor 100 Jahren durch Ausroden im Erlenbruchmoor und durch die Melioration des Alten Fritz entstanden waren.
Das charakteristische Landschaftsbild dieser Gegend war geprägt von feuchten Wiesen, sumpfigen Niederungen, flachen Seen und Bewässerungskanälen. Felder, Streuobstwiesen, kleinere Berge und Hügel, Schafherden, Wassermühlen, Dörfer und naturbelassene Eschen-Alleen bildeten gemeinsam mit einem kleinräumigen Wechsel der Biotope eine abwechslungsreiche und stille Kulturlandschaft.
Aus der Eiszeit stammendes Schmelzwasser bahnte sich damals in breiten Tälern seinen Weg von Osten nach Westen und es entstand das Havelgebiet. Der Busch war einst schwer passierbares Grenzgebiet nach Sachsen. Die alten Heerstraßen in der Heide, der Bau der Chaussee und Eisenbahn hatten das Gebiet verändert. Diese gewaltigen Umwälzungen fanden tatsächlich an unserem Dorfrand statt, wobei die Dorfgrenze auch eine Ländergrenze darstellte.
Die neu erschlossenen Ackerstücke von Berndorf führten daher auch geschichtsträchtige Namen. In der Ferne arbeiteten Bauern in der Bauernheide, der Kossätenheide und der Herrenheide. Weiter zum Dorf hin gab es die vordersten Lehmruten, die Buchtenden und die Galgenenden.
Die Fuhrwerkswege vom Dorf verliefen zur Autobahnbrücke oder in den Busch und waren ziemlich eng. Manchmal konnten zwei volle Wagen nicht aneinander vorbei. Die Heufuhren kamen ins Rutschen, der Gesprächsstoff für das Dorf war geliefert. Der Dorftratsch blühte wieder auf und zog in Windeseile von Haus zu Haus.
Diese Haltung schien regelrecht vererbt, denn alle Nachbarn mussten von jeher zusammen halten und die Informationen kamen immer nur durch das Reden über Andere zustande. Vor allem hinter dem Rücken der Betroffenen und wenn eine Familie neu ins Dorf gezogen war. Der Hauptumschlagplatz für diese Geschichten war der Laden, in dem man sich täglich zum Einkaufen traf.
Die Bauern nutzten gerade verlaufende Trampelpfade zum Dorf, welche über Acker und Felder verliefen, querfeldein lagen, um vom Hof zu ihrem Feld zu kommen. Im Sommer meistens trocken und glatt, passten diese Wege ihren Zustand der Jahreszeit an und konnten matschig oder hart gefroren sein.
Sie führten auch über Getreidefelder und zerteilten Wiesen, machten Abkürzungskurven, wenn es nötig schien oder, wenn Felder neu angelegt wurden, konnte so ein Weg über Nacht verschwunden sein. Dann gab es verdutzte Gesichter oder lautstarkes Fluchen, je nach Temperament der Betroffenen.
Hatte man sich an einen Weg gewöhnt, kostete es Mensch und Tier manche Mühe, Umwege zu machen und sich neu einzustellen. „Er steht da wie der Ochse vor dem neuen Scheunentor, “ hieß es dann.
Um die Mittagsstunde des warmen Augusttages lagerten die Dorfleute jeweils in der Nähe von ihren Feldstücken unter Eichenbäumen, die an den Wegrändern wuchsen, im weichen Gras. Man zählte das vierte Jahr in Friedenszeiten.
Die Arbeit ruhte in der Hitze einige Zeit, Harke, Mistgabel oder Kuhgespann waren abgestellt. Ein feiner Wind ließ die Eichenblätter rauschen. Auch einige wenige Kinder saßen abseits im struppigen Gras, nutzten den Schatten der Eichen und suchten vierblättrige Kleeblätter, die Glück bringen sollten. Männer, Frauen und Kinder ließen sich die Klappstullen schmecken, schoben sie zwischen die Zähne, spülten mit Malzkaffee nach und wischten die Brotkrümel von den Arbeitsjacken oder den nackten Oberkörpern.
Nach der Rast ackerten sie weiter auf ihren Feldern bis zum späten Abend, während die Sprösslinge sich neckten, Haschen spielten oder die Kleinsten am Schlafittchen nahmen und mit sich schleppten.
Das zu trocknende Gras wurde im Tageslauf mit dem Rechen mehrmals gewendet. Am Abend fertigte man kleine Haufen. Am anderen Tag wurden diese Grasschwaden auf die tautrockene, gemähte Wiese wieder ausgestreut, im Laufe des Tages das liegende Gras mehrmals umgewendet und abends wieder gehäuft. Dasselbe geschah am folgenden Tag mit dem bereits trockenen Gras nochmals. Die abends geschichteten Heuhaufen waren jetzt schon bedeutend größer. Wenn das Heu zur Einfahrt geeignet war, brachte der Bauer mit seinen Pferden manchmal gleich zwei zusammengehängte Leiterwagen auf die Wiese. Dabei hatte er auch die großen dreizinkigen Heugabeln zum Aufladen. In diesen Jahren gab es kaum Pferde. Sie waren unter den Opfern des Krieges zu suchen. Die Zucht brauchte Zeit und ausgeruhte Tiere. Wer noch im Besitz eines oder sogar zwei dieser vierbeinigen Schätze war, verborgte sie nicht oder nur sehr ungern. Meist hatten die Bauern jedoch zwei Kühe vor einem Heuwagen.
Читать дальше