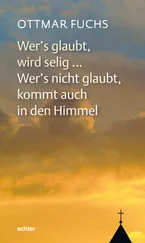Thorsten Reichert
Wer's glaubt wird selig
Eine Ermutigung zur persönlichen Spiritualität
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Thorsten Reichert Wer's glaubt wird selig Eine Ermutigung zur persönlichen Spiritualität Dieses ebook wurde erstellt bei
Einleitung
Glauben heißt vertrauen
Glaube als Beziehung
Das Problem mit Gott
Glaube = Liebe
Ich glaube - aber woran?
Glaube in Gemeinschaft
Glaube und Fußball
Spiritualität - wie geht das?
Spiritualität - ein Schatz
Abschiedsspiritualität
Glaube und Musik
Glaube und Humor
Kann man Spiritualität lernen?
Spiritualität: ein Segelschiff
Impressum neobooks
Als am 11. September 2001 die Flugzeuge ins World Trade Center einschlugen waren abends die Kirchen landauf landab voll, obwohl es mitten in der Woche war und die Gottesdienste oder Andachten spontan einberufen worden waren. Die Massivität des Schreckens, den die Terroranschläge hervorriefen, machte uns geradezu unfähig die Bilder im Fernsehen zu verarbeiten. Auch wenn der Terror weit weg geschehen war und keine unmittelbare Gefahr für uns in Deutschland bestand, die Anschläge trafen auch uns, weil sie Urinstinkte in uns hervorriefen: das Mitleid mit den Opfern und Angehörigen, aber auch die Fassungslosigkeit darüber was in einem Menschenhirn vorgehen muss einen solch diabolischen Plan zu schmieden und schließlich auszuführen. Vielleicht war dies vor allen anderen Dingen der Grund, warum Menschen den Weg in die Kirche suchten: weil sie keine Antworten auf ihre Fragen nach dem Warum finden konnten. Natürlich war das in den Kirchen nicht anders, kein Priester und keine Pastorin wird den Versuch gewagt haben eine Antwort zu geben. Der Trost, den Menschen vielleicht trotzdem gefunden haben, muss wohl darin gelegen haben, dass die Fragen Raum bekommen konnten. Dieser Raum wurde auf unterschiedlichste Weise geschaffen. In einem Gottesdienst konnten Menschen Kieselsteine mit ihren Gebeten beschriften, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde. Letztlich lag da in der Kirche ein großer Steinhaufen voller Fragen und Gebete, der eindrücklich an die Trümmer des Ground Zero erinnerte. Ich studierte zu jener Zeit in Heidelberg. Dort wurde am Abend des 11. September in der Heilig-Geist-Kirche, der größten Kirche direkt am Marktplatz, der täglich von tausenden Touristen bevölkert wird, das Requiem von W. A. Mozart aufgeführt, ich nehme an der Chor hatte es für ein kommendes oder vergangenes Konzert fertig einstudiert. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, überall standen Menschen, die keinen Sitzplatz gefunden hatten. Die größte Glocke des Turmgeläuts eröffnete die Andacht, eine mächtige Glocke, deren durch das große, enorm hohe Kirchenschiff hallender tiefer Klang eine gespenstische Stimmung hervorrief, zu der vor dem inneren Auge die nicht mehr zu löschenden Bilder der einschlagenden Flugzeuge abliefen.
Als die Glocke verklungen war setzte in die absolute Stille der knapp 1000 Besucher der Chor ein: „Kyrie Eleison – Herr, Erbarme dich“. Wer dieses vielleicht düsterste und voluminöseste Werk Mozarts kennt, der kann sich vorstellen, dass in dem Moment jeder der Anwesenden eine Gänsehaut hatte. Es war die Kombination aus den Schreckensbildern, der gespannten Atmosphäre und den geradezu archaischen Klängen von Glocke und Chor, die in jedem von uns etwas auslöste: Trost. Die Angst, die uns angesichts der Fernsehbilder erfüllt hatte, erhielt endlich ein Gegengewicht, und das nicht durch große Worte oder Beschwichtigungen; es war vielmehr ein Raum vorhanden sich mit den Ängsten und Gefühlen auseinanderzusetzen, die einen seit der ersten Nachricht von den Anschlägen erfüllt hatten. Obwohl ich selbst Theologe bin und daher natürlich die spätere Ansprache des Pastors besonders gespannt verfolgte habe ich keinerlei Erinnerung daran – die Musik dagegen, die Atmosphäre, die Gefühle während der Andacht haben sich bis heute tief eingeprägt. Ich bin sicher, dass kaum jemand nach einer knappen Stunde die Kirche mit einer konkreten religiösen Botschaft verlassen hat obwohl durchaus von Gott, von seiner Liebe und all diesen Dingen erzählt worden war, die eben in der Kirche zu Sprache kommen; und doch waren wir alle getröstet, denn wir hatten Raum gefunden für unsere Angst.
„Not lehrt beten“, dieser Satz ist wohl so alt wie das Gebet an sich. Schon immer waren Kirchen nie voller als zu Kriegszeiten, das Bedürfnis nach religiöser Gemeinschaft nie ausgeprägter als in Momenten größter Angst und Bedrängnis. Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz des Menschen zu sein, dass er in guten, glücklichen Zeiten weniger Bedürfnis nach Gemeinschaft hat als in Zeiten der Not. Das lässt sich auf ähnliche Weise auch in Beziehungen und Freundschaften sehen: Hat die beste Freundin einen neuen Partner, so hört man wochenlang nichts von ihr, gibt es Ärger mit dem Partner, dann hängt man mehrmals täglich am Telefon oder muss schon mal den einen oder anderen „Krankenbesuch“ machen. In der Geschichte der Kirche ist das nicht anders. Schon zu Zeiten des Neuen Testaments, als Jesus Nachfolger suchte, fand er diese in erster Linie unter den niedrigen Schichten der Bevölkerung: Fischer, Handwerker, Hausfrauen, Prostituierte. Sie hatten - im Gegensatz zu gesellschaftlich situierten Schichten wie Gelehrte oder Beamte - naheliegenderweise eher die Hoffnung, dass sich durch die Gemeinschaft der Nachfolge Jesu eine Verbesserung ihrer Lebenssituation finden würde. Im Mittelalter fanden klösterliche Gemeinschaften ihren Nachwuchs ebenfalls zuoberst in jungen Menschen, die aus ärmsten Verhältnissen stammten. Selbst die Gottesdienste, die sämtlich in lateinischer Sprache abgehalten wurden und daher für die Bauern und Handwerker vollkommen unverständlich blieben, wurden von diesen stark frequentiert. Sicherlich mag das auch mit dem mangelnden „Alternativprogramm“ und der Drohkulisse des Fegefeuers zusammengehangen haben, welche die Kirche damals nicht wenig eindrücklich predigte. Das Sprichwort „Not lehrt beten“ offenbart sich aber auch zu jenen Zeiten ebenso wie in unserem Jahrhundert, in welchem die christlichen Kirchen nirgendwo sonst so einen enormen Zulauf erfahren wie in den von Armut beherrschten Ländern Afrikas und Südamerikas. Wen wundert es also, dass wir in Deutschland, einem der wohlhabendsten und am besten abgesicherten Länder der Welt, die Umkehrung des Sprichworts erleben können: Reichtum braucht keinen Gott. Noch drastischer könnte man vielleicht formulieren: Wohlstand ist unser Gott. Wenn Not beten lehrt, dann ist Wohlstand und finanzielle Sicherheit ein wenig wie Arbeitsalltag nach 20 Dienstjahren: Man hat längst vergessen was man in der Ausbildung einmal gelernt hat. Das meiste hat sich als unwichtig oder nicht anwendbar erwiesen, das Wissen, mit dem man den Arbeitsalltag bestreitet, hat man sich vor allem durch Routine und Erfahrung angeeignet. Auf Glaube übertragen heißt das soviel wie: Das Gottesbild der Kindheit oder die Sehnsucht nach Spiritualität, wie sie in der letzten Lebenskrise vor Jahren vorhanden waren, sind einem gesunden Selbstbewusstsein gewichen. Es ist leichter an sich selbst zu glauben und auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen als auf einen Gott, dessen Fähigkeiten, Handlungsweisen, ja dessen Existenz ganz und gar nicht klar ist. Unser Glaube ist größtenteils auf uns selbst gerichtet. Wo es früher noch hieß: „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“ (was aus biblischer Sicht im Übrigen sehr fragwürdig ist und daher ein Beispiel für „religiöse“ Sprichwörter der beginnenden Neuzeit darstellt, die von einem Umschwung des Gottvertrauens auf das Selbstvertrauen zeugen), da sollte man heute sagen: „Vergiss Gott, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied!“
Читать дальше