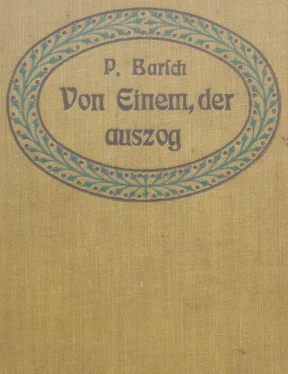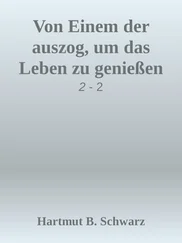Das war eine tiefe, große, keusche Liebe. Doch sie währte nur eine halbe Stunde.
Als diese gnadenreiche Zeit verronnen war, kam die Königin meines Herzens abermals in die Werkstatt. Freudig trat ich ihr entgegen und erhob die Hand zum Empfange; doch ließ ich schnell die Hand sinken, da meine heiße Freude einen jähen Tod fand. Cäcilie blieb in der offenen Tür stehen und rief kurz und grob: „Hier wird itze geschlossen!“
Sie war wieder die kalte, herrliche Person, die uns Lehrjungen das Lebe sauer gemacht hatte. Der plötzliche Stimmungsschlag in meiner Seele brachte mich in Zorn und ich fragte gereizt und gekränkt: „Halten Sie mich für einen Spitzbuben?“
„Sei nicht so frech Lausigel!“ schrie sie. „Wenn die andern fort sein, brauchen wir Dich erst recht nicht!“
„Ich bin hier in der Lehre, und ich habe noch nicht ausgelernt!“ entgegnete ich keck. „Vorhin erst haben Sie mich gebeten, dass ich hier bleiben soll!“
„Ich verreise itze!“ sagte sie schroff. „In zehn Minuten wird alles abgeschlossen, und wenn Du noch drin bist, lass ich Dich rausschmeißen!“
Sie schlug die Tür heftig zu und ging nach ihrer Wohnung. In rasender Wut riss ich die Tür auf und schrie Cäcilie ein gemeines Schimpfwort nach. Die Wagenbauer wunderten sich über meine Kühnheit und lachten. Zu ihnen gewendet, erklärte ich laut und noch immer von Wut geschüttet, dass Cäcilie das ordinärste Frauenzimmer und die schlechteste Person sei. Ich sprang auf den Boden, packte geschwind meine kleine Habe zusammen, mit Ausnahme der Betten, die meiner Mutter gehörten, und verließ mit Bündel und Stock das Werkstattgebäude. Im Hofe schoss Cäciliens Mutter auf mich los, schlug mich mit der Faust auf den Kopf und in den Nacken, so dass mir die Mütze in den Schnee fiel, und schalt mich unter gröblichen Schimpfreden wegen der Beleidigung ihrer Tochter. Als ich zur Abwehr den Stock erhob, spie sie mich an und entfloh.
Nach wenigen Minuten lag das Stadttor hinter mir, und ich wanderte dem fernen Tale meiner Heimat zu… Meine große Liebe war erloschen. Für Cäcilie blieb mir nur Verachtung. Dennoch übermannte mich die Scham, wenn ich mir die bösen Auftritte vergegenwärtigte, die sich beim Abschied ereignet hatten. Ich hätte das schändliche Wort nicht sprechen sollen. Eine Stimme in mir belehrte mich immerzu, dass nur gemeine Menschen sich solcher gemeinen Worte bedienen. Als ich mir dann noch den bitteren Vorwurf machte, dass ich Cäcilie in Gegenwart ihrer Mutter auf das ärgste in der Ehre gekränkt hatte, schlug ich mich in Reue und Selbstverachtung an die Stirn.
Spät abends trat ich in das Stübchen meiner Mutter. Sie kniete am Bett und betete den Rosenkranz. Erschrocken stand sie auf.
„Junge, wu kimmst Du den har?“
„Aus der Stadt.“
„Du bist doch nich ernt ’m Meister ausgerückt?“
„Nee, Mutter! Der Meister ist uns ausgerückt.“
Ich besaß keine Heimat mehr. Von Stunde zu Stunde kam mir dieses wehe, trostlose Gefühl deutlicher zum Bewusstsein. Die Mutter war gut zu mir und sorgte für mich mit opferfroher Liebe. Sie ehrte mich, wie einen lieben Gast, und buk mir zu Ehren Tiegelkuchen. Doch ich war eben nur noch Gast in ihrem Stübel; ich gehörte nicht mehr zu ihr. Mit weichen, schonenden Worten gab sie mir das zu verstehen.
Der Vater war seit mehreren Jahren tot. Die Mutter hatte unser Häuschen verkauft und sich freie Wohnung im Stübel ausbedungen. Der Kaufvertrag enthielt die harte Bestimmung, dass ich nur bis zum sechzehnten Jahre berechtigt sei, bei der Mutter zu wohnen. Wolle sie mit mir zusammenleben, so müsse sie in eine andere Wohnung ziehen. Der Hauswirt, ein schrullenhafter Mensch, fasste die Bestimmung so auf, dass ich ohne seine Erlaubnis nicht einmal bei der Mutter übernachten dürfte. Nur auf vieles Bitten hin gestattete er ihr zögernd, mich einige Tage lang zu beherbergen. Die Mutter grämte sich, weil sie in diese Stelle des Vertrages eingewilligt hatte; sie meinte, Mutter und Sohn gehörten von Natur aus zusammen. Doch während ihre Tränen noch flossen, widersprach sie ihrer eigenen Rede. Sie sagte, wenn die jungen Schwalben flügge seien, müssten sie das Nest verlassen und sich selbst ihr Futter suchen. So sei es überall in der Natur, und ich müsse daher, da ich nun siebzehn Jahre zählte, auf Selbstständigkeit bedacht sein.
Bei solchen Reden beschlich mich eine große Bangigkeit. Ich kam mir vor, als sei ich überflüssig in der Welt, und ich fühlte nicht die Kraft, mir einen sicheren Platz unter der Menschheit zu erringen.
Das Stübel war ein kleiner Anbau aus Lehm. Es mochte wohl schon hundert Jahr alt sein, da es dem Einfallen nahe war. Von allen drei Seiten war es mit Baumpfählen gestützt, und sowohl im Winter, als auch im Sommer waren die Außenwände mit Laub und dürren Kartoffelkraut bekleidet, weil sonst durch die vielen Löcher und Brüche Regen, Schnee und Wind eingedrungen wären. Der Raum, den zwei Betten, ein Tisch, ein alter rissiger, rauchgeschwärzter Kachelofen, ein Glasschrank, eine Kommode und zwei Stühle übrig ließen, war so eng, dass zwei Personen kaum zur Not sich darin bewegen konnten. Trotzdem war das Stübel hübsch und traulich. Alle die Gegenstände riefen Erinnerungen an meine Kindheit in mir wach; ich betrachtete sie gern, und oft erfasste mich ein Erstaunen, weil ich Eigenheiten an ihnen wahrnahm, die mir früher entgangen waren. Am liebsten sah ich den Glasschrank. Hinter blank geputzten Scheiben standen in drei Fächern viele feine bemalte Kaffeetassen und Andenken an berühmte Wallfahrtsorte. Am schönsten schien mir eine Kapelle aus Porzellan, in der ein goldener, verschnörkelter Hochaltar mit einem Muttergottesbilde zu sehen war. In geschliffenen Gläsern lagen bunte Ostereier, rote Äpfel, merkwürdig gewachsenen Melonen und geweihte Gebilde aus Wachs, wie sie der Jungfrau Maria von kranken Menschen als Opfer dargebracht werden. Auch Wachsstöcke und farbige Kerzen waren vorhanden, darunter die heilige Totenkerze, die gebrannt hatte, als der Vater und die Geschwister starben… In einem Fache fiel eine reichhaltige Bilderausstellung auf. Dort waren alle die Heiligen, die dem Herzen der Mutter besonders nahe standen, in bunten Bildern versammelt. Auch unheilige Bilder befanden sich in dieser Versammlung. Da war zum Beispiel ein Schornsteinfeger, der eine Müllerin küsste. Dann ein betrunkener Mann, der aus dem Gasthause kam und dem ein Affe im Nacken saß. Verschiedenartige Einladungskarten erinnerten an Tanzkränzchen und Wurstabendbrote längst vergangener Jahre. An den Wänden hingen Wallfahrtsmadonnen, Heiligenbilder, Papst Pius und die eingerahmten Patenbriefe.
Die Mutter war arm. Für das Haus hatte sie nur wenige hundert Taler bekommen, und der größte Teil dieses Geldes war bei der Tilgung der Schulden zerflossen. Sie bestritt ihren Lebensunterhalt auf verschieden Weise. Gewöhnlich arbeitete sie als Tagelöhnerin bei den Bauern. Sie verstand auch, die Nadel gut zu führen. Nicht nur Mägde, auch Bauersfrauen ließen Schürzen, Röcke und Jacken von ihr anfertigen. Von Vater, der Tischler gewesen, hatte sie verschiedene Künste erlernt, die sie ebenfalls zu ihrem Nutzen verwertete. Zuweilen polierte sie bei Gutsherrschaften alte Möbel frisch auf und leimte herab gefallene Zierstücke fest. Sie flocht Stuhlsitze und strich Hof- und Gertenzäume, Tore, Türen, Fenster und Geräte mit Ölfarben an. Das ganze Jahr hindurch war sie immerzu beschäftigt, und wenn sie in ihren Lohnforderungen nicht gar zu bescheiden gewesen wäre, hätte sie ein gutes Auskommen haben können. Geld bekam sie selten; gewöhnlich nur Ersatz für ihre baren Auslagen. Als Lohn für ihre Mühe erhielt sie Brot Speck, Fleisch, Kartoffeln und Erbsen. An Lebensmitteln war sie manchmal so reich, dass sie die Armen des Dorfes beschenken konnte. Solches Wohl tun war ihre beste Freude. Sie bildete sich dabei ein, dass sie im Überfluss lebe. Obwohl sie zu manchen Zeiten viele Tage lang kein Geld besaß und in arger Bedrängnis schwebte, klagte sie nie über Armut. Sie war ganz anders, als andere Frauen. Auch die reichsten Bäuerinnen jammerten gern über schlechte Zeiten und machten dabei Gesichter, als wühlte der Hunger bereits in ihren Leibern. Meine Mutter rief dann lachend: bei ihr sei keine Not; sie habe mehr Schuldner, als der Großbauer. Gegen das Armsein und Entbehren müssen hegte sie einen tiefinnerlichen Widerwillen. Viele Leute, die von ihr beschenkt wurden, besaßen Acker, Vieh und Haus und wohl auch mehr Geld als die Mutter; dennoch wurden sie von ihr als arme Leute bedauert. Oft erklärte sie, dass sie sich schon längst ein Sofa beim Sattler bestellt hätte, wenn nur das Stübel nicht zu klein dazu wäre.
Читать дальше