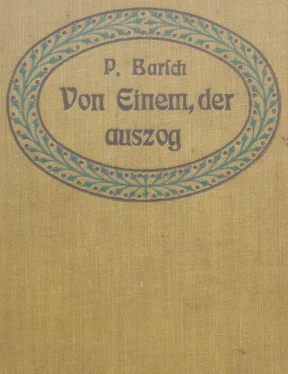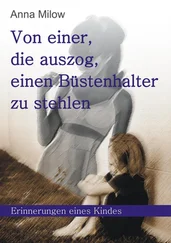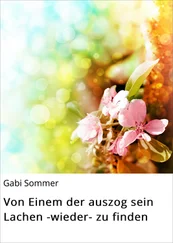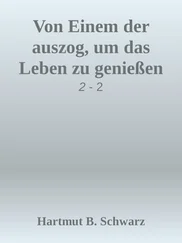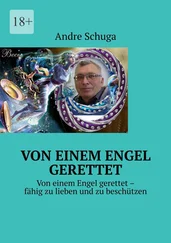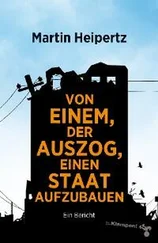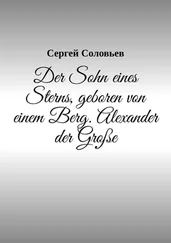In der Werkstatt ging bunt und toll zu. Von den fünf Gesellen hatten sich drei entfernt; nur der lange Lorenz und der polnische Lukas waren zurückgeblieben. Diese beiden saßen auf ihren Hobelbänken, tranken „Gemischten“ und fluchten auf den verschwundenen Meister. Der lange Lorenz, der gern und mit Stolz in den Erinnerungen einer herrlichen Vergangenheit schwelgte, erzählte wieder einmal allerlei Bruchstücke aus seiner reichen Lebensgeschichte und zog dabei Vergleiche zwischen sich und dem Meister. Er sei ein berühmter Fabrikbesitzer und ein großer Kapitalist gewesen; mit Champagner und Rotwein habe er ein gewaltiges Vermögen fortgeschwemmt; in der Equipage sei er gefahren; sieben Wohnungen und sieben Weiber habe er gehabt, ohne die übrigen Liebsten, und zuletzt sei er fechten gegangen. Für seine Arbeiter und Gesellen aber habe er gesorgt, bis letzten Augenblick. Tief in den Rachen hinein würde er sich schämen, wenn er damals beim großen Krach feige fortgelaufen wäre und seine Leute in Stich gelassen hätte. So etwas bringe nur ein ganz gemeiner Lump fertig.
Der polnische Lukas hörte nicht zu, wenn der lange Lorenz erzählte; er beschäftigte sich nur mit sich selbst, schüttelte den Kopf und knirschte hörbar mit seinem schneeweißen Zähnen. Ab und zu hieb er in raschen und kurzen Wutanfällen mit dem Hammer auf die Hobelbank. Am sechsten oder siebenten Tage nach dem Verschwinden des Meisters wurde er plötzlich so wütend, dass er den Hammer ergriff und das kunstvoll zusammengefügte Gestell eines Zimmerspringbrunnens, das er mühsam gebaut hatte, in kleine Stücke zerschlug. „Psiakrew, die Bestie!“ schrie er. „Krieg’ ich noch nix bezahlt! Soll sich holen Diable ganze verfluchtige Arbeit!“
Uns Lehrjungen behagte das alles. Wir hatten die uns aufgetragenen Arbeiten vollendet; nun konnte wir mit ruhigem Gewissen müßig gehen. Cäcilie kümmerte sich wenig um uns; nur wenn sie eines Dieners oder Boten bedurfte, ließ sie einen von uns durch das Dienstmädchen rufen. Sie kochte das Essen, wie sie es sonst getan hatte, und wir bekamen auch unsern Vesperkaffee. Bei Tisch konnten wir uns jetzt nach Belieben satt essen. Das war früher nicht immer möglich gewesen. Die Sitte gebot, dass ein Lehrling nicht öfter als zweimal während des Mittagessens seine Teller aus der Schüssel füllen durfte. War einer beim Füllen des Tellers zufällig von Meister oder von Fräulein Cäcilie angeblickt worden, so hatte ein solcher Blick lähmend eingewirkt auf die Hand des Jungen, und dieser war dann mit ungestillter Esslust vom Tische weggegangen. Das kam jetzt nicht mehr vor, da Fräulein Cäcilie aus Gram oder Scham dem Tische fern blieb, wir also unsere Teller bis an den Rand füllen konnten. Solches Leben gefiel uns, und die Frage, wie es einmal enden solle, machte uns keine Sorgen.
Um nicht den Blicken und die Kritik des langen Lorenz ausgesetzt zu sein, versteckten wir uns im Ofenwinkel der Werkstatt. Dort vertrieben wir uns die Langeweile durch dichterische Versuche. Wir waren Dichter geworden. Franz reimte ein Gedicht, in dem er seinen Stiefvater einen Geizkragen nannte und ihm prophezeite, dass er für jedes Zehnpfennigstück, das er ihm, dem guten Stiefsohne, auf Erden als Taschengeld vorenthalte, einst je ein halbes Jahr lang im Fegefeuer braten werde. Johann beklagte es in bitteren Versen, dass heutzutage dem Käseleim aus Billigkeitsgründen der Vorzug vor dem Kölner Leim gegeben werde. Ich dichtete ein Trauerspiel. Das sollte fünf Akte haben und den Titel führen: „Das vertauschte Kind.“
Wie wir zu Dichtern geworden waren?
Im Vorderhause befand sich eine große Wagenbauwerkstatt, und der Wagenbauer hatte einen erwachsenen Sohn, der sich uns Tischlerstiften gegenüber freundlich zeigte. Nach Feierabend durften wir manchmal zu ihm in die Werkstatt kommen; dort saßen wir auf Schemeln und Schnitzbänken und plauderten. Gern redete er von seiner Schwester, die mit einem Assessor verlobt war. Er erzählte uns, dass sie ein großes Glück machte. Der Herr Assessor sei der klügste Mann in der ganzen Stadt, und weil er so klug sei, dürfte er sogar den Herrn Staatsanwalt vertreten. Wie gelehrt er sei, gehe schon daraus hervor, dass er Schillers Werke besitze. Diese Werke habe er jetzt seiner Braut geliehen, damit die darin lese und gleichfalls die höhere Bildung erlerne.
Die Mitteilung, dass man aus Schillers Werken die höhere Bildung erlernen könne, fesselte mich mächtig, und der Assessor und seine Braut, die so überglücklich waren, aus diesem Urquell der Bildung schöpften zu können, erschienen mir wie höhere Wesen. Ich fragte unsern gütigen Freund, ob er wisse, was in Schillers Werken zu lesen stünde, oder ob er mir ungefähr sagen könne, wie sie äußerlich und innerlich beschaffen seien. Er gab zur Antwort: „Es sind Bücher, wie alle andern Bücher; aber was darin steht, da können wir uns alle gar keinen Begriff davon machen. Wer Schillers Werke gelesen hat, weiß alles – kurzum alles! Da steht alles drin, was die klügsten Menschen wissen müssen. Wenn einer etwas nicht weiß, braucht er bloß in Schillers Werken zu suchen, und er findet es.“
„Das ist wohl aber schwer zu verstehen?“ fragte Johann.
„Für uns ist es nichts!“ sagte kopfschüttelnd der junge Wagenbauer. „Meine Schwester ist in der Klosterschule gewesen; dort hat sie verdammt viel gelernt. Wenn das nicht wäre, verstände sie kein Wort davon. Es ist auch vieles lateinisch und in andern Sprachen.“
Ich wusste, dass Schiller ein Dichter war, hatte jedoch noch keine nähere Kunde über ihn vernommen und noch kein Wort von ihm gelesen; auch war mir unbekannt, wo und in welcher Zeit er gelebt. Ich konnte mir kein Bild von dem menschliche Wesen und den Werken des Dichters machen; doch ich hegte die dunkle Vorstellung, dass er ein Mensch gewesen, der mit seinem Geiste über die höchsten Grenzen des menschlichen Wissens hinausragte und wohl gar in Beziehungen stand zu weisen, übernatürlichen Mächten. Er erschien mir wie das größte und verehrungswürdigste Geheimnis, und ich hätte vielleicht meine Geistigkeit hingegeben, um dafür einen Blick in seine Bücher tun zu dürfen und im Fluge einige der Worte zu erhaschen, die geeignet waren, mir den Weg zur höchsten Bildung zu weisen. Zaghaft verriet ich dem Bruder der glücklichen Braut meine Sehnsucht. Er aber sagte, die Bücher seien so wertvoll, dass die sorgsam gehütet werden müssten. Schiller lag mir fortan im Sinn, und wenn die Braut sich oben am Fenster blicken ließ oder über den Hof ging, betrachtete ich sie mit scheuen Blicken der Andacht. Sie las ja jeden Tag in Schillers Büchern; somit war ich überzeugt, dass ihr alle Weisheit dieser Welt kund und offenbar war. Deutlich sah ich ihr an, dass sie ein unendliches Wissen und die allerfeinste Bildung besaß. Sie fühlte sich auch so erhaben über uns alle, dass sie nicht einmal dankte, wenn wir sie grüßten. Johann behauptete, sie sei die dümmste Gans in der ganzen Stadt und bilde sich einen großen Fetzen ein, weil sie einen Assessor heirate. Er würde sie nicht zur Frau mögen, auch wenn sie hunderttausend Taler hätte; denn sie habe das Gesicht einer Schleiereule. Mich empörten solche Worte gewaltig; sie berührten mich wie eine freche Entweihung einer geheilten Erscheinung, und es kam deshalb zwischen Johann und mir zu bösen Auftritten, bei denen wir uns gegenseitig schmerzhaft an den Haaren zerrten. Ich wusste besser als er, wie das Fräulein zu solchen Stolze kam. Wer Schillers Bücher gelesen hatte, war ebenso über alle Maßen klug, dass er unmöglich noch auf dumme Menschen unseres Schlages achten konnte.
Eines Abends ärgerte mich der junge Wagenbauer. Wir betrachteten gemeinsam ein Bild der Stadt Paris, das ein Gesell an die Wand geklebt hatte, und ich äußerte dabei, es sei aus der Vogelperspektive aufgenommen worden. Das merkwürdige Wort hatte ich zuweilen unter Städtebildern gelesen, doch nicht klar im Gedächtnis behalten und so es jetzt falsch zum Vorschein gekommen. Das belustigte den älteren und klügeren Freund, und er verhöhnte mich so arg, dass ich tief gekränkt und weinend in ohnmächtigen Zorn davonlief. Nach einer Weile kam er in unsere Werkstatt und entschuldigte sich. Ich solle kein Narr sein und mich einer solchen Kleinigkeit wegen nicht ärgern. Als er siebzehn Jahre gewesen, habe er das Wort Vogelperspektive auch noch nicht aussprechen können. Er befand sich in so guter Laune, dass ich den Mut fasste, ihn noch einmal zu bitten, mir doch einen Band aus Schillers Werken zu zeigen. Wider mein Erwarten willigte er nach einigem Sträuben ein. „Aber nur zeigen“ sprach er und ging hinauf in seine Wohnung.
Читать дальше